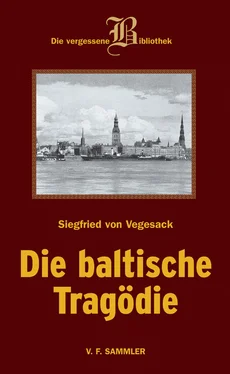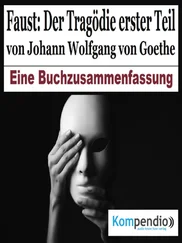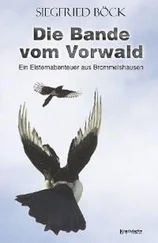Beim Abstreifen meiner alten Windjacke griff ich in die Tasche. Da kam der Zettel meines Jungen zum Vorschein. Ich gab ihn Dir. Du lasest ihn und sagtest kein Wort. […] Mitten in der Nacht wachte ich auf. Die Cresciente? Nein. Du schluchztest. Noch nie hatte ich Dich weinen gesehen. Ratlos saß ich da und begriff nichts. Der Mond, der über dem Gemäuer aufgegangen war, schien auf Dein Gesicht, über das unaufhörlich Tränen liefen. Und dann sagtest Du: ‚Nein – du mußt zurück. Du kannst den Jungen nicht im Stich lassen. Unser Glück wäre zu teuer erkauft. Wir müssen verzichten…‘
In jener Nacht fielen alle meine Träume zusammen. Du hattest recht. Du kanntest mich besser als ich mich. Du dachtest an mich – und nicht an Dich. Ich konnte nicht bei Dir bleiben – ich mußte zurück…“ – Ein seltsam verdichtetes Zusammenspiel, denn auch von Gotthard, seinem ersten Sohn, soll er bald Abschied nehmen: 1944, erst zwanzigjährig, ist Gotthard von Vegesack in Polen als Flieger gefallen. Als Nachruf erscheint 1947 Vegesacks Gedichtsammlung „Mein Junge“, in der er seiner Trauer Ausdruck gibt.
Im Mai 1938 reist der Dichter zurück nach Deutschland, nutzt die knapp zweijährige Tätigkeit als Auslandskorrespondent für seinen ersten Reisebericht „Unter fremden Sternen“ (1938). „Es war ein großes Glück für mich, daß ich noch kurz vor Tores-Schluß so viel von der Welt sehen und mich mit unvergeßlichen Eindrücken vollpumpen konnte“ , schreibt Vegesack im März 1940 an Kubin. „Sie tragen Ihre Welt in sich und brauchen deshalb nur aus Ihrem Innern zu schöpfen; bei mir ist das anders: ich muß mir alles hereinholen, muß die Dinge leibhaftig sehen, damit sie im Innern lebendig werden! Aber nun bin ich für Jahre versorgt!“ Erzählungen aus Argentinien (1940), Paraguay (1941), Chile (1942) und Brasilien (1947) entstehen. Stets bildet die Grundstimmung immer wiederkehrender Schwermut und Melancholie den fruchtbaren Boden für Vegesacks Humor. Die Liebesgedichte, die der Bewunderer Schopenhauers über Nena schreibt, sind „durchzogen vom Wissen um die Zerbrechlichkeit des Glücks, aber immer wieder auch erfüllt von jener Weisheit des Heimatlosen, den sein entwurzeltes Leben lehrte, daß man nur das besitzt, was man ganz verlor: das vollkommen Verinnerlichte. So wird auch verinnerlichte Liebe selbst durch Ozeane nicht getrennt“, schreibt Franz Baumer – es sind melancholische Liebesgedichte. Für Vegesacks zweite Frau Gabriele, „Jella“ genannt, ist das Ertragen seiner Zerrissenheit sicher nicht leicht: Von Anfang an hat sie von seiner fernen Liebe gewußt, nie aber geglaubt, daß diese so unauslöschlich sein würde. „So ganz allein im Turm – das ging doch nicht auf die Dauer. Meine zukünftige Frau […] ist ein lieber, warmer, völlig unkomplizierter Mensch – gerade das, was ich brauche!“ schwärmt der Ledige: „So wird nun im Turm ein neues Leben beginnen – ich wollte fort, aber er läßt mich nicht los, und nun werden sogar neue Wurzeln geschlagen. Ich habe das Gefühl, daß ich Ihrem Beispiel folgen, mich immer tiefer hier vergraben und von der Welt da draußen abschließen werde. Aber dazu braucht man einen Menschen, der die Einsamkeit teilt, – sonst erfriert man. Und ich glaube, daß ich diesen Menschen gefunden habe!“ schreibt er am 1. März 1940 an Kubin. Im April heiratet er Jella, die Tochter eines Obersten aus Würzburg, zum Jahresende wird ihr gemeinsamer Sohn Christoph geboren.
Doch bald schon ist Vegesack von der Familie getrennt: „Als der Krieg im Osten ausbrach, meldete ich mich […] freiwillig als Dolmetscher“ , erzählt er in seinem Rechenschaftsbericht. Im Mai 1942 setzt ihn ein Flugzeug in Poltawa ab; von dort aus trampt der 54jährige „ohne Auto und keinem Vorgesetzten unterstellt, kreuz und quer, meist in Lastwägen oder Güterzügen, im Süden bis in die Krim und den Kaukasus, und im Norden nach Reval und Narwa hinauf“ . Als „Sonderführer“ kommt er in die Ukraine, nach Georgien, schließlich auch in die alte Heimat: „Als Dolmetscher im Osten hatte ich mich anfangs noch einigen Illusionen hingegeben. Doch mit der Zeit wurden meine Eindrücke immer skeptischer. Im Frühjahr 1944 erhielt ich vom damaligen Chef des Wirtschafts-Stabes-Ost – General Stapf – den Auftrag, auf Grund meiner Berichte und eines umfangreichen Materials von Dokumenten, die mir zur Verfügung gestellt wurden, eine Denkschrift über die ‚Behandlung der Bevölkerung‘ in den von uns besetzten Gebieten zu schreiben, und zwar so, wie ich die Dinge sehe, ohne jede Rücksicht auf höhere Dienststellen. Einzelheiten dieser Denkschrift hatte ich mit Graf Peter Yorck von Warthenberg besprochen, der bei uns im Stab tätig war .
Am 17. Juli 1944 lieferte ich meine Denkschrift in Berlin ab. Schon am nächsten Tag empfing mich General Stapf mit den Worten: ‚Wissen Sie, was Sie da geschrieben haben? Eine furchtbare Anklage!‘
Ich erklärte dem General, daß ich meine Denkschrift so geschrieben hätte, wie es mir befohlen war: ohne jede Rücksicht, so wie ich die Dinge sehe. Den 20. Juli erlebte ich in Berlin. Gleich darauf wurde ich von General Stapf nach Weißenstein beurlaubt .
Erst später habe ich erfahren, daß General Stapf mit Graf Yorck von Warthenberg zu den Verschwörern gehörte und daß meine Denkschrift gleich nach geglücktem Attentat veröffentlicht werden sollte. Im letzten Augenblick, als General Stapf am 20. Juli sich in die Bendlerstrasse zu Graf Yorck begeben wollte, wurde er gewarnt, so daß er zu Hause blieb und meine Denkschrift nicht in die Hände der Gestapo gefallen ist. Später bin ich zwar von der Gestapo in Regensburg verhört worden, aber man konnte mir nichts nachweisen. Graf Peter Yorck wurde hingerichtet. Im Oktober 1944 nahm ich meinen Abschied.“
Sein erstaunlich unabhängiger und deutlich kritischer Bericht „Als Dolmetscher im Osten. Ein Erlebnisbericht aus den Jahren 1942–43“ kann erst 1965 erscheinen. „Bei der Aussicht, die eine Gewaltherrschaft (der Bolschewiken) nur durch eine andere (die deutsche) zu vertauschen, zu einer deutschen Kolonie herabzusinken und als ‚weiße Neger‘ und ‚Untermenschen‘ für den deutschen Herrn zu schuften, war es kein Wunder, daß auch die deutschfreundlichen Elemente, die uns mit Begeisterung als Befreier begrüßt hatten, in kurzer Zeit alle Sympathie für uns verloren und wieder dem Bolschewismus zugetrieben wurden. […] Man kann kein Volk gewinnen, wenn man ihm ständig seine Minderwertigkeit vor die Nase hält, ganz abgesehen davon, daß diese Völker alles andere als minderwertig sind“ , heißt es in seinem von Paul Rohrbach, dem politischen Schriftsteller, als „Geheimschrift“ gewürdigten Text.
Auch als Dichter setzt Vegesack sich mit der Herrschaft der Nationalsozialisten auseinander; als Versuch, ihren Aufstieg und die ungeheure Zustimmung in Deutschland für Adolf Hitler zu erklären, entsteht im Februar 1946 „Das Weltgericht von Pisa“ – eine von Thomas Mann lobend hervorgehobene Erzählung, die sich mit der Schuldfrage befaßt.
Gerhard Storz, der Präsident der Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung, in die der Balte 1956 berufen worden war, würdigt in einer Festschrift zu Vegesacks 80. Geburtstag die moralische Autorität und Integrität dieses Mannes: „Er hat sie sich erworben, weil er an das Gute im Menschen glaubt“. Nicht nur die Stadt Regen hat den Dichter nach dem Zweiten Weltkrieg ausgezeichnet, indem sie ihn zu ihrem Ehrenbürger macht: 1961 erhält er den Literaturpreis und 1973 die Ehrengabe der Stiftung zur Förderung des Schrifttums, 1963 den Ostdeutschen Kulturpreis der Künstlergilde Esslingen. Anläßlich der Verleihung des letzteren verliest er sein Glaubens-„Bekenntnis“: „Mag es auf unserem kleinen Planeten auch wie in einem Tollhaus zugehen, so glaube ich doch, allem Niedrigen und Niederträchtigen zum Trotz, an das Gute im Menschen, an seine Bestimmung, an den Sinn und den Wert dessen, was das Leben lebenswert macht: an Tapferkeit, Ritterlichkeit, Duldsamkeit, Treue und Lauterkeit der Gesinnung, an die große, den ganzen Erdball umspannende Kameradschaft und Brüderlichkeit aller, die guten Willens sind.“
Читать дальше