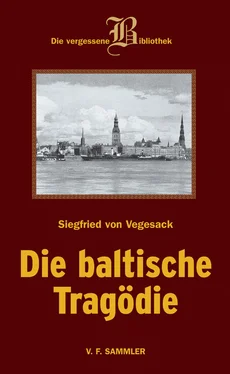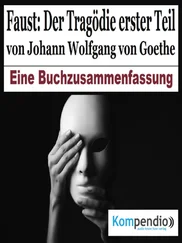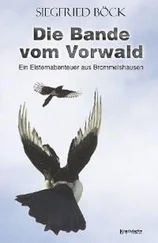Erst 1966, fast ein halbes Jahrhundert, nachdem er den Turm bezogen hat, wird er einem Bekannten melden können: „Der Turm ist jetzt warm, in allen Stockwerken warmes Wasser!“ Der Name –„fressendes Haus“ – ist geblieben: Heute zählt es zu den kulturellen Sehenswürdigkeiten der Stadt Regen; neben dem Vegesack-Nachlaß beherbergt es im Erdgeschoß die Dichterstube als Erinnerung an das Schriftstellerpaar.
Es ist der mit ihm eng befreundete Zeichner Alfred Kubin, der ihn ermutigt, seine Erinnerungen an die baltische Heimat niederzuschreiben. Sein Hauptwerk, „Die Baltische Tragödie“, wird daraus entstehen, die mit der 33. Auflage im Jahr 1981 über 157.000 Exemplare erreicht. Siegfried von Vegesack wird zum Gestalter der baltendeutschen Lebenswende, zum „Historienmaler unter den Autoren der baltischen Welt“, so Wolfgang Schwarz in seinem Nachruf. Und der schöpferische Impuls entlädt sich wie ein Sturzbach. Als er am 12. März 1933 einige Tage in „Schutzhaft“ genommen wird, weil er die Hakenkreuzfahne, die „eine Horde von braunen Uniformen aus Regen“ auf dem Turm der Weißensteinschen Burgruine gehißt hatte, wieder herunterholen ließ, schreibt er in der Gefängniszelle „ungestört“ und „in aller Ruhe“, wie er lakonisch bemerkt, den ersten Teil der Trilogie zu Ende. In nur 43 Tagen hat er den Roman „Blumbergshof“ fertiggestellt.
„Das Buch lebt aus der Ursprungs- und Heimatwelt seines Dichters. Sorgfältig umhegt und doch schon Vergänglichkeitsschauern ausgesetzt, wächst ein verträumter Junge heran im ländlichen Herrenleben des Vorkriegsbaltikums, inmitten einer großen, von prachtvollen schrulligen Originalen durchsetzten Verwandtschaft“ – so umreißt Werner Bergengruen den Auftakt zur „Baltischen Tragödie“. Wie der Mittelteil ist er weitgehend autobiographisch geschrieben – Blumbergshof und Altschwanensee sind die Orte seiner Kindheit, und auch der Autor selbst träumte dort von einem Studium der Musik und war unglücklich in eine Kusine verliebt, bis er Clara Nordström kennenlernte. Die Welt seines Alter Egos Aurel ist die patriarchalische Welt der dünnen deutschen Oberschicht, und schon bald wird sich der kleine Protagonist bewußt, daß ihn eine „gläserne Wand“ von den lettischen Pächtern und Dienstleuten, von Janz, Karlin, dem alten Marz, der schwarzen Tina und Mikkel mit dem Daumenstumpf, trennt: „Es gab eben zwei Welten: die eine war still, mit bunten Dielenläufern, feiner Butter, Flüstern, gedämpften Schritten. Und die andere war laut, mit Quark und Gelächter und weißem Sand auf dem Fußboden.“ Die Gleichheit aller vor dem Gesetz gilt in Livland nicht – auch wenn die Leibeigenschaft 1816–19 aufgehoben wurde. Und Aurel wehrt sich innerlich gegen die Standesunterschiede – er will kein „Jungherr“ sein. Doch er muß erkennen, daß Traditionen und Vorurteile eine Überwindung dieser Distanz unmöglich machen: entgegen der starken Verbundenheit, die er seinen lettischen Untergebenen gegenüber verspürt. Auch Vegesack selbst vertritt diese Position: In den zwanziger Jahren wird er sogar aus dem Adelsbund ausgeschlossen, weil er sich in seinen – heute verschollenen – „Fürstengedichten“ gegen die Vorrechte des Adels gewandt hat.
In den Folgebänden wird der politische Hintergrund zunehmend bedeutsamer; Vegesack weitet seinen Entwicklungsroman eines jungen baltischen Adligen aus zur Schicksalsgeschichte einer ganzen Volksgruppe. Er schildert den Umsturz der alten Ordnung im Baltikum, die Ära der Russifizierung und Unterdrückung der deutschen Kultur während der Zarenherrschaft, die Grausamkeiten während der lettischen, estnischen und russischen Revolution von 1905 und schließlich den Verlauf des Ersten Weltkriegs im Baltikum: die Unabhängigkeitsbestrebungen der Letten und Esten, die Kämpfe zwischen Rot und Weiß, den todesmutigen Einsatz der „Baltischen Landeswehr“ zur Befreiung der Heimat von der Bolschewikenherrschaft, die in Riga vom 3. Januar bis 22. Mai 1919 wütet, und die blutigen Kämpfe des aus deutschen Freikorps aufgestellten „Baltenregiments“ im Frühjahr 1919 gegen das kommunistische Rußland. Am Ende kommt es zur Landreform und damit zur Enteignung der Deutschen, die bis dahin die führende Schicht in Livland, Kurland und Estland gebildet hatten. 700 Jahre lang, seit der Christianisierung des Baltikums durch den Deutschen Ritterorden, hatten sie das kulturelle Antlitz dieses Landes geprägt.
In „Herren ohne Heer“ beginnt sich Aurel der außerordentlichen Gefährdung der Deutschen in ihrem Leben als Minderheit bewußt zu werden, „denn Herren ohne Heer zu sein, ist“, wie Vegesacks Landsmann, der Dichter Otto von Taube, in einer Rezension schreibt, „das natürliche Los aller Kolonisten.“ Aurel erlebt die reale Bedrohung der Idylle als Einbruch in das Magische seiner harmonisch-behüteten Kinderwelt, dem schließlich im „Totentanz in Livland“ der heroische Untergang folgt. Nicht zuletzt kommt in den sehr unterschiedlichen Haltungen und Interessen der weit verzweigten Familie von Onkeln und Tanten des Aurel von Heidenkamp, die vom „angerussten“ Onkel Jegor bis zum dünkelhaften Vertreter deutschen Junkertums, Graf Bork, reicht, die innere Zerrissenheit der deutschen Minderheit zum Ausdruck. Auffällig ist auch die ironische Distanz, mit der die Stimme des Erzählers auf ihre Hauptperson, die in der großen Weltgeschichte doch nur zur „kleinen baltischen Nebenfigur“ wird, hinabschaut.
Tragödie – das bedeutet nach Ansicht des Erzählers eine Tragödie, die schon im 15. Jahrhundert begann, weil die von ihr betroffene Volksgruppe „allzuweit vom Mutterland abgesprengt“ war; das bedeutet aber auch die innerlich erlebte Tragödie im Konflikt all jener, die die große, heroische baltische Vergangenheit reflektieren und in Selbstzweifel geraten. Gefangen in ihrer Zerrissenheit müssen sie die baltische Tragödie in sich ausfechten – sie kommen auf der Suche nach Identität gegen die traditionellen Bahnen und die Last der Vergangenheit, das schwere Erbe, nicht an, so Carola Gottzmann in ihrem Aufsatz „Die baltische Tragödie in Aurel von Heidenkamp“: „Die Bürde der Geschichte, die auf dem Menschen ruht, fließt nicht nur mit dem Verhängnis des gewaltsamen Untergangs zusammen, sondern spielt sich auch in den Menschen ab. Die baltische Tragödie findet in Mischka, in Nix und in Aurel statt, während andere Personen des Romans, wie Balthasar, Onkel Nicolas, Jegor, Oscha, Rembert, Tante Olla und andere Verwandte und Bekannte von ihr als von außen kommende Macht überrollt werden.“ Aurel vergleicht sich selbst und seine Brüder mit dem Ehrfurcht einflößenden Werdegang seiner Ahnen: In seinem Bruder Balthasar sieht er einen Nachfahren derjenigen, die mächtige Herren in den Hansestädten gewesen waren – sein Bruder Christoph setzt die Tradition derer fort, die Soldaten waren. Reinhard repräsentiert für ihn den Bauern, der mit Zähigkeit und Geduld an seiner Scholle hängt: von einem westfälischen Bauerngeschlecht, das im 15. Jahrhundert nach Livland eingewandert war, stammen sie ursprünglich ab. – Und er? Die Selbsterkenntnis und Bilanz seines eigenen Lebens am Schluß des Werkes lautet: „So haben die großen Brüder das Erbe der Vorfahren unter sich aufgeteilt und dir, dem Jüngsten und Letzten, blieb nichts Richtiges übrig.“
Zentrales Thema der „Baltischen Tragödie“ ist der Verlust. Immer wieder muß Aurel gerade das verlieren, wozu er seine Zuneigung entfalten möchte, eine Bindung aufbauen kann – seien es nun Haustiere oder geliebte Menschen. Bereits der erste Band ist geprägt durch diese einschneidende, schmerzhafte Erfahrung: Ihm entschwinden besonders jene, die er am meisten liebt: seine Amme, der Hauslehrer oder der beste Freund. So wird dem sensiblen, verschlossenen Knaben ein Sich-Öffnen nur schwer möglich. Schließlich ist es der Tod des Vaters, der zum Begreifen des Endgültigen, des „Nie wieder“ führt.
Читать дальше