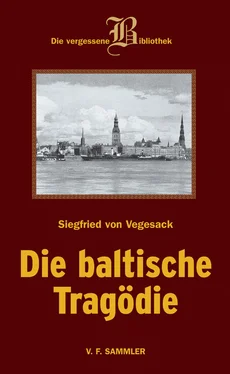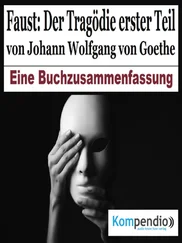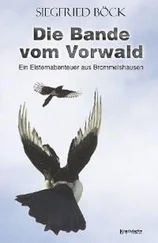„Was hat mich eigentlich hier festgehalten?“ sinniert der 75jährige in dem über ihn gedrehten Fernsehfilm. „Diese Landschaft, das Land, die sind doch hier ganz anders als in meiner alten Heimat in Livland. Und doch: etwas Gemeinsames haben beide: diese Weiträumigkeit, den weiten Horizont und den Wald.“ So ist ihm auch der Bayerische Wald zur vertrauten Atmosphäre geworden. „Hier spürst du“ , schreibt er ein anderes Mal, „umwittert vom Spuk, noch einen Hauch der Urzeit, den Atem natürlichen Bodens. Wenn deine Seele krank ist, dann verbirg dich, wie ein verwundetes Tier, in den Wäldern: sie werden dich heilen.“ Vielleicht auch deshalb verspürt er ein Unbehagen davor, einmal auf einem „alljemeinen Friedhof“ liegen zu müssen, wie er seinen Freunden regelmäßig mit dem melodisch-schwingenden Tonfall seiner baltendeutschen Mundart anvertraut.
Wie die Natur liebt Vegesack die Einsamkeit, die Stille, das Schweigen. In seinem Essay „Vom Schweigen“ heißt es: „Im Anfang war das Wort, aber vor dem Wort war das Schweigen. Nur aus der stummen Einsamkeit Gottes wurde das Wort und damit die Welt geboren. Gott brach als erster das Schweigen, und seitdem haben wir Menschen es in immer wieder kleinere Stücke zerbrochen. Vom großen Schweigen ist uns nicht viel übriggeblieben. Im Gebirge, auf dem Meere, in tiefen Wäldern, mittags, in der Stunde Pans, oder nachts unter brennendem Sternenhimmel verspüren wir noch zuweilen einen Hauch von jenem Schweigen, aus dem einst die Schöpfung hervorrollte… Und wenn du auch den ganzen Erdball mit Antennen umspannst und neben jedem Kilometerstein einen Lautsprecher aufstellst – einmal, kleiner Mensch, wirst du doch in jenes Schweigen zurückkehren, aus dem einst die Schöpfung rollte und Gott uns hinausstieß.“
In dieses Schweigen zieht er sich im Alter immer mehr zurück: bis er, der Wortkarge, schließlich gar kein Wort mehr spricht – nachdem im Mai 1972 Jella, seine 15 Jahre jüngere Frau, unerwartet gestorben war. Keine zwei Jahre später, am 26. Januar 1974, folgt Vegesack ihr nach. In einem Nachruf erinnert sich Hermann Stahl des Dichters als eines Mannes „von untadeliger Aufrichtigkeit und vielschichtiger Interessen, herzlich, formbewußt, von so klarer wie liebenswürdiger Intelligenz und Geradheit, nobel und fern jedweder Möglichkeit der Medisance, rechtschaffen und künstlerisch, ein Mann ohne äußere Prätention, Bewohner eines steilen Turms, in dem es Stolz gab und langsames Sich-Gewöhnen jahrzehntehin, Mühsal, Disziplin und manchmal beschwiegenes Heimweh wohl auch, auch Not zum Ende hin, bis sie und alles, fast alles, ferngerückt war zuletzt, in einem Turm bei Regen im Bayerischen Wald, einem Turm aus Stein, nicht aus Elfenbein.“
Nur ein paar Steinwürfe von diesem Turm entfernt, auf einem einsamen Bergrücken, fand der Dichter seine letzte Ruhestätte – in einem Freigrab neben seiner Frau Jella am Waldesrand, das er den Behörden in einem jahrelangen Kampf abgetrotzt hatte. Über diesem hängt – am Stamm einer Kiefer – sein Totenbrett, auf dem, durchdrungen von Vegesacks feinem Humor des Sich-nicht-so-Ernst-Nehmens, zu lesen ist:
Hier, wo ich einst gehütet meine Ziegen ,
Will ich vereint mit meinen Hunden liegen!
Hier auf dem Pfahle saß ich oft und gern:
O, Wandrer, schau dich um und lobe Gott, den Herrn!
Meike Bohn
Diese Blätter sollen die Tragödie der Balten, ihr Martyrium und ihren heroischen Kampf der Vergessenheit entreißen. Nichts soll beschönigt, nichts bemäntelt, eigene Schuld nicht abgeleugnet werden. Die baltische Tragödie bedarf keiner Verherrlichung, dem harten Schicksal wird nur harte Wahrheit gerecht. Es bleibt genügend, worauf wir Deutschbalten mit Recht stolz sein dürfen.
Nichts ist erfunden, nichts erdichtet. Auch der kühnsten Phantasie blieb nichts zu erdichten übrig: die Wirklichkeit hat ihr alles vorweggenommen. So mußte sich die Feder damit begnügen, die Ereignisse ohne jede Ausschmückung wahrheitsgetreu niederzuschreiben.
Auch der „General“ ist keine Erfindung: er ist der Urgroßvater meines Großvaters mütterlicherseits, Balthasar Freiherr von Campenhausen, der als Trabant unter Karl XII. bei Poltawa kämpfte und später in den Dienst Peters des Großen trat.
Die Personen in diesem Roman sind dagegen – bis auf wenige Ausnahmen – frei erfunden, wenn sie auch einzelne Züge lebender Vorbilder tragen.
Grundsätzlich wurden nur Berichte und Mitteilungen von Augenzeugen verwendet. Besonders wertvoll waren für mich die Aufzeichnungen von: Hamilkar Baron Fölckersam, Alfred von Hedenström, Max von zur Mühlen, A. Baron Ungern-Sternberg, Dr. Arved von Vegesack und Arnold Freiherr von Vietinghoff, denen ich meinen herzlichen Dank ausspreche.
Weißenstein im Bayrischen Walde
Siegfried von Vegesack
Dem Andenken der Vorfahren, den Nachkommen zur Erinnerung


„Die kleine Frühlingsnacht des Lebens verfließe dir ruhig und hell – der überirdische Verhüllte schenke dir darin einige Sternbilder über dir – Nachtviolen unter dir – einige Nachtgedanken in dir – und nicht mehr Gewölk, als zu einem schönen Abendrot vonnöten ist, und nicht mehr Regen, als etwa ein Regenbogen im Mondschein braucht!“
Jean Paul
Im Anfang war eine große, weiche Dunkelheit, eine wohlige Wärme und tiefes Geborgensein. Nur manchmal wanderte der blaue Schein einer kleinen Öllampe durch das Dunkel und warf gespensterhafte Schatten an die Wände. Wie groß, fast bis zur Decke, wuchs Karlomchens Buckel! Das Licht huschte hin und her, und dann wurde es wieder finster.
Aurel lag in seinem schmalen Gitterbett, streckte die kleinen Hände nach den hölzernen Stäbchen aus, die ihn wie in einem Käfig gefangenhielten. Aber die Stäbchen ließen sich wenigstens drehen, und das gab einen lustigen, quietschenden Ton. Und wenn er mit den Armen noch weiter nach unten vortastete, konnte er sogar ein weiches, warmes Fell erreichen, das dann gleich zu schnurren anfing. Nein, er war nicht allein: Minka war bei ihm. Jeden Abend, wenn Karlomchen gegangen war, sprang sie lautlos zwischen den Gitterstäben zu ihm ins Bett und blieb bis zum Morgen.
Aber noch war es finster. Auch wenn Janz, der Gartenjunge, in der Frühe mit der Stallaterne kam, um den Kachelofen zu heizen, war alles dunkel. Janz ging lautlos, wie ein Gespenst, in seinen Wollsocken; nur die Bohlen des Fußbodens knackten, und das Licht der flackernden Laterne schwankte hin und her, bis es vor der Holzkiste stillstand. Dann hockte sich Janz auf den Knien vor dem Ofen nieder, und jetzt konnte Aurel ganz deutlich im Schein der Laterne sehen, daß die rechte Socke auf dem Hacken ein Loch hatte, ein großes, rundes Loch.
Die Ofentür klapperte, das Feuer knisterte, prasselte; Janz schlurfte davon, aber die roten und gelben Lichter tanzten noch lange vor dem Ofen auf dem Fußboden, bis dann langsam die Dämmerung vom Fenster ins Zimmer stieg und es allmählich Morgen wurde.
Mila kam, Aurel wurde aus seinem Käfig herausgehoben, der Tag fing an.
Ein Tag war damals noch eine kleine Ewigkeit, oder vielleicht stand die Zeit überhaupt still, wie das Haus stillstand mit seinen weiten, hellen Räumen, den vielen weißen Kachelöfen und der alten englischen Standuhr, deren Räderwerk längst abgelaufen war und die ein merkwürdiges, heiseres Schnurren von sich gab, wenn man ihre Gewichte herunterzog.
Читать дальше