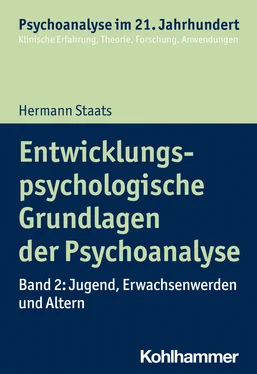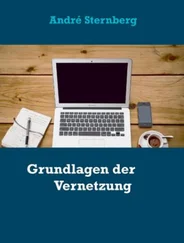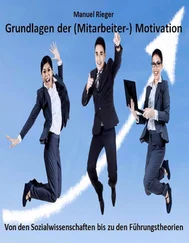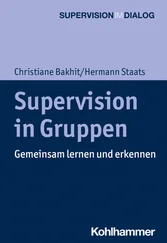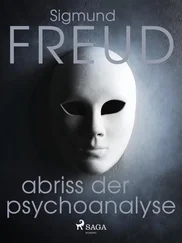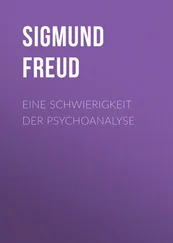Auch wenn Eltern sich um Gerechtigkeit bemühen – die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern sind unterschiedlich. Die Rolle eines Lieblingskindes, der »Prinzessin« oder des »Prinzen«, ist dabei auch eine Belastung für das Kind. Eine Einschränkung der Entwicklungsmöglichkeiten ist bereits in der Kindheit deutlich und kann – über anhaltende Konflikte mit den Geschwistern und nicht bewusste und nicht verhandelte Erwartungen zwischen Eltern und Kindern – über das ganze Leben hin wirksam sein. Im Einzelfall bleibt offen, ob das Erleben von Neid und Rivalität zwischen Geschwistern, wie es in der Geschichte von Aschenputtel so deutlich beschrieben ist, erfolgreich bewältigt oder zu einer bleibenden Belastung wird. Dies gilt ähnlich auch für sexuelle Erkundungen zwischen Geschwistern, in denen die Grenze zwischen Gewalt und einem einverständlichen Begehren und Erkunden nicht immer klar ist – und auch im Laufe des Lebens verschoben werden kann.
Einige Besonderheiten der Entwicklung von Geschwistern werden hier kurz angesprochen, weil sie hohe klinische Bedeutung haben. Scheidungen der Eltern wirken sich auch auf die Geschwisterbeziehungen aus ( 
Kap. 7.5
). Verluste können, zumindest zum Teil, in einer Patchwork-Familie wieder kompensiert werden. In diesen Familien liegt es an der Zusammenarbeit der einzelnen Familienmitglieder, ob die Entwicklung der Kinder durch ihre Geschwister gefährdet oder bereichert wird. Der Tod von Kindern bringt nachfolgende Geschwister in eine besondere Situation. Die Rolle eines »Ersatzkindes« ist häufig mit lang anhaltenden Schwierigkeiten in der Selbstentwicklung verbunden, die mit einem überdauernden Erleben von Schuld und Scham einhergehen. Auch das Aufwachsen mit stark behinderten Geschwistern oder Pflegekindern in der Familie bietet besondere Schwierigkeiten. Es ist eine Herausforderung, hier Unterschiede im Umgang mit den Kindern nachvollziehbar zu gestalten und nicht zu verleugnen. Lauterbach (2007) beschreibt, wie Geschwisterbeziehungen »flach« und wenig wichtig bleiben können. Sie führt dies auf eine Parentifizierung von Kindern zurück – hier bleibt die Entwicklung emotionaler Beziehungen auf der horizontalen Ebene aus.
Die Zeit der Latenz wird als ein »Stiefkind« der allgemeinen psychoanalytischen Theorien beschrieben. Weiterführende Literatur findet sich bei Endres und Salamander (2014) und – mit einem Bezug zu Konzepten von Bion und Klein – bei Diem-Wille (2015), die die Latenz als das »goldene Zeitalter« der Kindheit beschreibt.
Erikson beschreibt das Selbsterleben des Kindes in der Latenzzeit als ein »Ich bin, was ich kann«. Die Entwicklung von vielfältigen Fähigkeiten ist die zentrale Aufgabe dieser Phase. Kinder bilden soziale und intellektuelle Kompetenzen aus, die wiederum ihr Erleben verändern. Konflikte ranken sich um das lustvolle Erleben der eigenen Kompetenz und das »Noch-nicht-Können« mit Gefühlen von Versagen und Minderwertigkeit. Als Lösung entwickeln Kinder ein Vertrauen auf ihre grundlegenden sozialen und intellektuellen Fähigkeiten, die sich als verinnerlichte Struktur in den Erwartungen an sich selbst und an andere Menschen niederschlagen. Ödipale Konflikte und Dreieckskonstellationen (mit der Sicherung von Triangulierungsprozessen), die Integration unterschiedlicher Identifikationen und ihre Relativierung und die Selbstwertregulation spielen eine große Rolle. Vertrauen auf die eigenen Kompetenzen und die Welt und die Integration narzisstischen Erlebens – auch mit der Anerkennung von Differenzierung von Selbst und Objekt – dienen der Abwehr übermäßigen Neides und der Entwicklung sozial angepasster Rivalität. Eltern haben dabei die Aufgabe, ihre Kinder in der Familie an eine soziale Anpassung heranzuführen und in die Gesellschaft zu integrieren.
Geschwisterbeziehungen sind in der Regel die zeitlich längsten Beziehungen eines Menschen. Ihre Bedeutung wechselt über die Lebensspanne. Ein U-förmiger Verlauf mit starker Nähe und subjektiver Bedeutung am Lebensanfang und dann wieder im höheren Alter ist häufig. In psychoanalytischer Theoriebildung werden die Beziehungen von Geschwistern gegenüber den Erfahrungen mit den Eltern vernachlässigt.
Literatur zur vertiefenden Lektüre
Diem-Wille, G. (2015). Latenz. Das »goldene Zeitalter« der Kindheit. Psychoanalytische Entwicklungspsychologie nach Freud, Klein und Bion. Stuttgart: Kohlhammer.
Endres, M. & Salamander, C. (Hrsg.) (2014). Latenz. Entwicklung und Behandlung. Frankfurt am Main: Brandes & Apsel.
Kasten, H. (1993). Die Geschwisterbeziehung. Bd. 1. Göttingen: Hogrefe.
Mertens, W. (1996). Entwicklung der Psychosexualität und der Geschlechtsidentität. Bd. 2. Kindheit und Adoleszenz. Stuttgart: Kohlhammer.
Petri, H. (1994). Geschwister – Liebe und Rivalität. Zürich: Kreuz.
Sohni, H. (2011). Geschwisterdynamik, Familie und Psychoanalyse. Psychoanalytische Familientherapie 22, 3–32.
Fragen zum weiteren Nachdenken
• Beeinflussen gesellschaftliche Veränderungen den Ablauf der Latenzzeit? Gibt es – kulturell und geschichtlich – auch Modelle ohne Latenz (Kinder arbeiten früh und selbstverständlich mit)?
• Sehen Sie das zunehmende Reflektieren der eigenen Person in der Latenzzeit eher als einen bewussten oder unbewussten Prozess?
• »Ein Kind ohne Geschwister aufwachsen zu lassen, ist so wie einen Menschen ohne Waffe in den Krieg ziehen zu lassen«(Volksmund) – Erleben sich Einzelkinder anders als Kindern mit Geschwistern? Was machen Sie für unterschiedliche Erfahrungen?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.