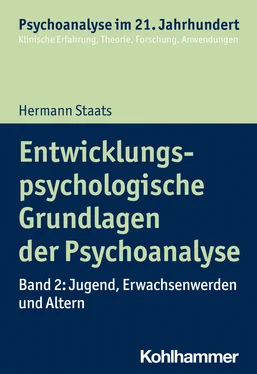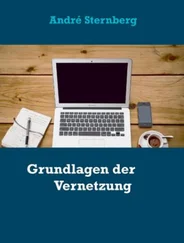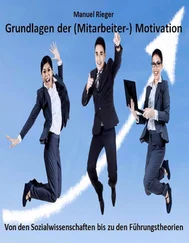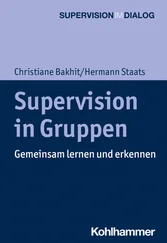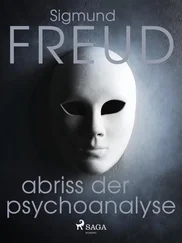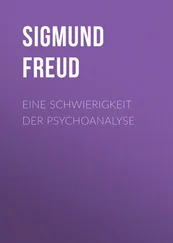2.4 Latenz im Hinblick auf die kognitive Entwicklung
Um das siebte Lebensjahr herum beginnen Kinder, etwas von der Leichtigkeit abzulegen, mit der sie Gefühle und Gedanken spontan äußern. Dafür treten Bemühungen, Triebe zu unterdrücken, und logisches sowie rationales Denken in den Vordergrund. Regeln, die unter anderem im gemeinsamen Spiel erworben werden, sind für das Kind in dieser Zeit von großer Bedeutung. Gruppennormen werden verinnerlicht und haben immer mehr Bestand. Mit dem Verständnis gemeinsamer sozialer und moralischer Regeln werden Dinge und Sichtweisen neu bewertet. Magisches Denken weicht der Objektivität und Realität. Es werden also verstärkt Primär- (Triebe, unbewusst) und Sekundärprozesse (logisches Denken, bewusst) voneinander abgegrenzt und operationales Denken beginnt. Kinder entwickeln ein Verständnis für Vergangenes und Zukünftiges und können sich selbst und ihre Gedanken reflektieren (Tulodziecki et al., 2004, S. 24). Ein reflektierendes Nachdenken über Handlungen verändert bestehende Sichtweisen. Welt und Umwelt werden mit dem Ziel eines Erkennens objektiver Sachverhalte erkundet. Kinder verlassen die Perspektive des Erlebens der Welt als weitgehend auf sich selbst bezogen – sie »dezentrieren«. Dennoch bleiben Primärprozesse in der Latenzzeit deutlich erkennbar bestehen, und auch egozentrische Sichtweisen haben weiterhin Bestand.
»Ein Kind mag zwar in der Lage sein, im Rahmen eines Schulversuchs die unveränderliche Konstanz eines Gewichts oder Volumens zu erkennen, sich anderseits jedoch schnell betrogen fühlen, wenn das Stück Kuchen der Mutter vermeintlich größer ist als sein eigenes« (Tyson & Tyson, 2009, S. 193).
Auch die Triebimpulse und das Bemühen um deren Regulation spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Dezentrierung und der Selbstreflexion. Zunächst verstehen Kinder noch nicht, dass und wie die Gefühle anderer ihre eigenen Gefühle beeinflussen. Es ist ein Entwicklungsfortschritt, sich mit den Augen anderer zu sehen. Stolz und Scham entwickeln sich zu eigenständigen Empfindungen. Sie sind in der Latenzzeit meist noch an die reale Präsenz anerkennender Personen gebunden und werden erst in der Adoleszenz unabhängiger von der Realpräsenz anderer. Ambivalente Gefühle werden ab dem 9. Lebensjahr bewusst erlebt und geschildert. Dies bereitet das sich und anderen »Fremd«-Werden der Präadoleszenz ( 
Kap. 3
) vor. Hohe und lange andauernde Anspannungszustände erschweren die Entwicklung von Selbstreflexion (ausführlicher hierzu Tyson & Tyson, 2009, S. 190 ff. und Einschub ADHS).
Familie und Gesellschaft stehen in einer konflikthaften Beziehung in Bezug auf die Sorge für und um Kinder. Freud hat diese Konflikthaftigkeit als etwas Grundsätzliches betont. Zugleich waren in seiner Zeit die Aufgaben, die Familie und Gesellschaft zugeordnet wurden, vergleichsweise klar abgegrenzt und in der Gesellschaft wenig hinterfragt. Über die – schulische – Bildung hinaus werden Kita und Schule dagegen heute Erziehungsaufgaben zugesprochen und abverlangt. Das Leben mit Gleichaltrigen hat dabei oft auch die Aufgabe, das Leben mit Geschwistern (  Kap. 2.5) zu ersetzen.
Kap. 2.5) zu ersetzen.
Folgerungen für die Praxis: Aufwachsen in altershomogenen Gruppen und elterliches Verhalten
Ein – zeitlich umfassendes – Aufwachsen in altershomogenen Gruppen bringt spezifische Schwierigkeiten mit sich und verschiebt Ansprüche und Machtverhältnisse in Konflikten zwischen Schule und Familie. So werden Eltern selbstverständlich als Hilfslehrer angesprochen (sie sollen Schulaufgaben beaufsichtigen und mit ihren Kindern lernen); die Schule dagegen soll Beziehungskompetenzen vermitteln. Bildungsungerechtigkeit wird so tradiert. Eine längere Zeit in auf kognitives Lernen ausgerichteten altershomogenen Gruppen hat Folgen für spätere Beziehungen in Familien: Kinder lernen weniger leicht – spielerisch und nebenbei –, sich mit kleineren und größeren Kindern zu arrangieren. Betreuungskompetenzen werden nicht mehr selbstverständlich erworben. Das führt dazu, dass viele Eltern später, mit ihren eigenen Kindern, nicht oder kaum auf Erfahrungen im Umgehen mit kleinen Kindern zurückgreifen können. Die eigene Sozialisation (»das eigene kleine Kind«) ist dann vielfach ein von pädagogischen Fachkräften umsorgtes Kind. Eltern greifen daher auf diesen Teil ihres impliziten Beziehungswissens mit ihren Kindern zurück und nähern sich ihnen aus einer »pädagogischen« Perspektive – statt etwa Zeit mit ihnen lustvoll zu »verplempern«, mit ihnen zu spielen oder die Kinder an familiären Aufgaben selbstverständlich zu beteiligen (Staats, 2014).
Langfristige Konsequenzen des fehlenden Lernens im Umgang mit kleinen Kindern in der Latenzzeit finden sich als Überforderung von Eltern mit kleinen Kindern wieder. Kinder werden später selbständig beim Erobern ihres Raums und beim Erschließen von Beziehungen zu anderen Kindern – insbesondere anderen Alters. Neben diesen gesellschaftlichen Veränderungen durch eine frühe und ausgedehnte Erziehung von Kindern in altershomogenen auf Lernen ausgerichteten Gruppen spielt auch die geringere Anzahl von Kindern in einer Familie hier eine Rolle. Kinder werden stärker als »Projektkinder« oder – kritisch – als »Selbstobjekte« elterlicher Fürsorge beschrieben. Sie haben einen hohen Stellenwert für den Selbstwert der Eltern bekommen. Beziehungen zu Geschwistern werden hier als eine andere Form dauerhafter Beziehungen ausgleichend wichtig.
2.5 Geschwisterbeziehungen
Geschwisterbeziehungen werden an dieser Stelle des Buches erstmals angesprochen, weil sie in der Latenzzeit eine hohe Bedeutung haben. Kinder reflektieren hier bereits die Beziehungen zu ihren Geschwistern. Sie differenzieren ihre Rollen, vergleichen sich und bestätigen sich in ihren jeweiligen Positionen in der Familie. Die Ankunft eines neuen Geschwisters hat einen Einfluss auf die Entwicklung der – jetzt »älteren« – Geschwister. Sie sind nun »schon groß« und doch noch »klein«. Das Erleben des neuen Kindes und seiner Beziehungen zu den Eltern kann regressive Entwicklungen auslösen. Konkurrenz und Neid auf das Neugeborgene rücken dann in den Vordergrund. Auch progressive Entwicklungen mit der Übernahme von Pflegeverhalten und Verantwortung für den Neuankömmling in Identifizierung mit Mutter oder Vater sind häufig. In jedem Fall geht es um ein Sich-Abfinden mit etwas Unausweichlichem. Dies kann schon weit vor der Latenzzeit zu einer reflektierten Reaktion und damit einhergehenden Umgehensweisen führen.
Beispiel:
Ein Dreijähriger betrachtet intensiv den neu geborenen Bruder und kommentiert seufzend: »Den haben wir jetzt!«.
In der Regel sind Geschwister ein Leben lang miteinander verbunden – es sind die längsten Beziehungen unseres Lebens. Sie sind in vielen Fällen durch das gleichzeitige Vorhandensein von Zuneigung und Abneigung, Verbundenheit und Abgrenzung und von Liebe und Hass geprägt (Kasten, 1993).
Alfred Adlers (1927) Arbeiten zum Einfluss der Stellung eines Menschen in seiner Geschwisterreihe werden häufig als Beginn der Forschung zu Geschwisterbeziehungen betrachtet. Seine Ergebnisse sind in psychoanalytischen Theorien wenig aufgegriffen worden – Geschwisterbeziehungen werden hier in der Regel vor dem Hintergrund der Beziehungen zu den Eltern verstanden und auf deren Einfluss hin untersucht. Nur im Bereich der Gruppenanalyse ist ein stärkeres Interesse an horizontalen Beziehungen (gegenüber den vertikalen der Eltern-Kind-Beziehung) und den Konflikten in Geschwisterbeziehungen deutlich. Subjektiv wird die Beziehung zu Geschwistern und die eigene Stellung innerhalb der Geschwisterreihe als eine bedeutsame Entwicklungsbedingung erlebt. Empirische Untersuchungen stützen diese Einschätzung aber wenig. Einige Untersuchungen (z. B. Kristensen & Bjerkedal, 2007; Rohrer, Egloff & Schmukle, 2015) geben Hinweise darauf, dass ältere Geschwister stärker mit den Eltern identifiziert sind, häufiger bestimmende, helfende und lehrende Verhaltensweisen zeigen und etwas intelligenter sind als die jüngeren Geschwister. Die gemessenen Unterschiede sind aber gering und tragen zur Erklärung interindividueller Varianz im Einzelfall nur wenig bei. Adlers Arbeiten werden oft als unbestätigt oder wenig relevant betrachtet. Zu der Annahme, dass jüngere Geschwister flexibler seien und eine höhere soziale Kompetenz als ihre älteren Geschwister zeigten, führt Kasten (1998) kritisch aus, Untersuchungen hätten für diese Beschreibungen keine sicheren Anhaltspunkte ergeben. Aktuelle empirische Arbeiten mit hohen Teilnehmerzahlen zeigen allerdings, dass die Stelle in der Geschwisterreihe doch einen deutlichen Einfluss auf die Studien- und Berufswahl hat. Dies wird als Bestätigung der Bedeutung der Position zwischen den Geschwistern für die Persönlichkeitsbildung angesehen (Barclay, Hällsten & Myrskylä, 2017). Spezifische Fähigkeiten werden sowohl im Umgang mit kleineren und als auch mit älteren Geschwistern erworben. Sie wirken sich langfristig aus.
Читать дальше