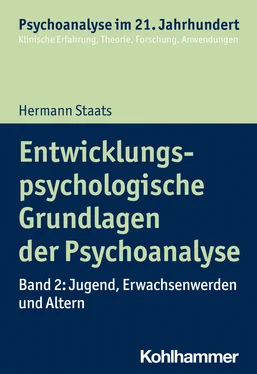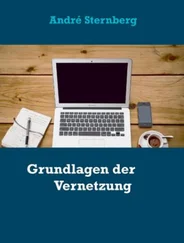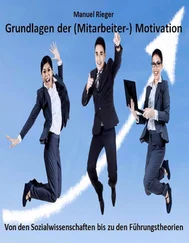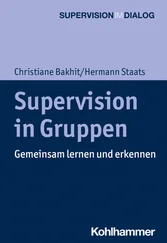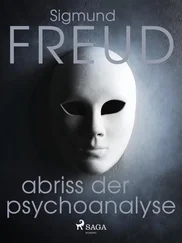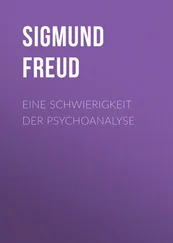Freud beschreibt, dass es in der Latenzzeit zu einem Nachlassen sexueller Impulse komme. Er berücksichtigte aber bereits die Vielfalt der Entwicklungen in dieser Zeit – bei einigen Kindern bleibt die Sexualisierung und eine damit einhergehende sexuelle Betätigung während der Latenzzeit bestehen. Mertens (1996) diskutiert die unterschiedlichen Auffassungen zum Persistieren sexueller Betätigung in der Latenzzeit und die Infragestellung dieses Konzepts: Ist es gerechtfertigt, von einer Zeit der Latenz zu sprechen? Die Unterdrückung sexueller Aktivität bleibt unvollständig; fast alle Kinder in der Latenzzeit zeigen sexuelle Aktivitäten wie Masturbation und sexuelles Phantasieren. Auch diese Aktivitäten unterstützen die Regulation innerer Spannungen. Ein gewaltsames Verbieten oder strikte Unterbindungen können zu einer Einschränkung der Ich-Entwicklung führen.
Folgerungen für die Praxis: Sexuelle Aktivität, Schuldgefühl und Zwänge
Symptome, die hauptsächlich in der frühen Latenz aufkommen, wie Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen, Konzentrationsmangel, antisoziales Verhalten, übermäßige Schuldgefühle oder Kastrationsängste, werden als eine Folge strikter Unterbindung sexueller Aktivitäten in der Latenzzeit beschrieben. Die »fast ausschließliche« Beschäftigung mit sexuellen Doktorspielen kann aber auch auf die sexuelle Überstimulation und Überforderung eines Kindes hinweisen (Mertens 1996). Inwieweit es dem Kind gelingt, seine sexuellen Aktivitäten sozial angemessen zu kontrollieren, die mit ihnen verbundenen Phantasien und Emotionen zu integrieren und ein positives Ich und Über-Ich zu entwickeln, hängt mit den Einflüssen des sozialen Umfeldes, der gesellschaftlichen und familiären Kultur zusammen (Tyson & Tyson, 2009).
2.3 Objektbeziehungen der Latenzzeit
Durch die Enttäuschung im Zusammenhang mit der Zurückweisung ödipaler Liebeswünsche und durch die wachsenden kognitiven Kompetenzen lösen sich Kinder vermehrt von ihren Eltern. Phantasien (wie die, ein adoptiertes Kind mit anderen Eltern zu sein) unterstützen Kinder in dieser Entwicklungsaufgabe. Freud hat diese Phantasien (1909) als den »Familienroman der Neurotiker« beschrieben. Bei allen – äußeren – Autonomieschritten und Lösungsversuchen bleibt das Über-Ich aber noch an eine Bestätigung elterlicher Auffassungen gebunden. Manche Psychoanalytiker sprechen von einer »Projektion« des Über-Ich auf die Familie. Diese Vorstellung ist aber auch missverständlich. Die noch geringe Distanzierung von familiären Normen kann vielleicht besser als strukturelle Einschränkung verstanden werden ( 
Kap. 3
und 
Kap. 4
zu den Veränderungen der Präadoleszenz und Adoleszenz).Mit der größer werdenden Distanz zu den Eltern und dem Wechsel zur Präadoleszenz wird es zunehmend als innere Instanz erlebt. Fragen nach einem »Richtig« und »Falsch« nehmen eine immer größere Rolle ein. Ältere Kinder leben ihre Phantasien vermehrt im Spiel und mit äußeren Objekten aus, meist mit Gleichaltrigen beziehungsweise in gleichgeschlechtlichen sogenannten Peergroups (Tyson & Tyson, 2009, S. 120 f.). Die Beziehungen zu Dingen werden wichtig. An ihnen wird gelernt. Spielzeuge und deren Funktionen werden erkundet und gepflegt und repariert, Sammlungen angelegt und damit Natur und Welt erkundet. Ein wenig wie in animistischen Kulturen kann von einer auch in den Dingen belebten Welt gesprochen werden. Sie kennen zu lernen und sich mit ihr vertraut zu machen ist eine Aufgabe, für die z. B. Erfahrungen in Kinder- und Jugendgruppen (wie den Pfadfindern) genutzt werden.
Von Klitzing und Stadelmann (2011) betonen unter dem Titel »Das Kind in der triadischen Beziehungswelt« die Bedeutung von Mehrpersonenbeziehungen für die kindliche Entwicklung.
»Die Fähigkeit von Eltern, die Beziehung zu ihrem Kind so zu gestalten, dass es in einen flexiblen triadischen Beziehungsraum hineinwächst, d. h. das beide Eltern jeweils die eigene Beziehung zum Kind ohne Ausschlusstendenz gegenüber dem Dritten entwickeln können und dass die Beziehung des Partners zum Kind akzeptiert und als Bereicherung angesehen werden kann, stellt für Kinder eine günstige Beziehungsvoraussetzung dar …« (S. 967).
Jungen sind für ihre Entwicklung stärker als Mädchen auf die Triangulierungskompetenz ihrer Eltern angewiesen und auf die Präsenz eines Vaters, der der Mutter liebevoll verbunden ist. Lern- und Verhaltensstörungen werden bei Jungen infolge eines Fehlens von Vätern (und von Triangulierungskompetenz) beschrieben. Söhnen fehle dann ein Schutz gegen äußere und innere Gefahren (Dammasch, 2008). Die Formulierung Freuds (1930, S. 430): »ein ähnlich starkes Bedürfnis aus der Kindheit wie das nach dem Vaterschutz wüsste ich nicht anzugeben« weist auf diesen Aspekt des Erlebens von Söhnen hin (zur Entwicklung in Ein-Eltern-Familien 
Kap. 7.5
).
Die Internalisierung eines triadischen Beziehungsmodus wird in der Latenzzeit wichtig und bereitet auf Erfahrungen in den Peergruppen der Adoleszenz vor. Ein Fehlen dieser Fähigkeit wird an den wachsenden sozialen Aufgaben der Latenzzeit deutlich. Interpersonelle Schwierigkeiten des Kindes können dann nicht mehr familiär aufgefangen werden. Mit dem Besuch einer Schule wird ein Teil der Verantwortung für die Entwicklung des Kindes von den Eltern auf die Bildungsstätte verlagert. Außerhalb der Familie auftretende interpersonelle Schwierigkeiten können zu einem Rückzug aus den Gruppen Gleichaltriger führen, zu einem Rückzug auf familiäre Strukturen oder in digitale Welten ( 
Kap. 5
).
Die strukturellen Veränderungen in der Latenzzeit führen zu einer Neuorganisation der Abwehr. Sie bereiten die Selbständigkeit vor, die in unserer Kultur auch mit einer partiellen Lösung von den familiären und gesellschaftlichen Normen und Erwartungen verbunden ist. Vor diesem Hintergrund kann die Latenzzeit auch als etwas Spezifisches für bestimmte Kulturen betrachtet werden. »Kindheit« wird unterschiedlich verstanden und mit unterschiedlichen Erwartungen und Rollenaufgaben verbunden. Vor allem in der Zeit des Übergangs von der Latenzzeit in die Adoleszenz (Präadoleszenz, 
Kap. 3
) treten zunehmend phantasierte Gefahren (z. B. »Monster«) auf. Hier werden existentielle Befürchtungen und deren Bewältigung bearbeitet. Angesichts des Erlebens realer Gefahren wie Trennungen oder Todesfällen bekommen diese Phantasien eine Bewältigungsfunktion. Sie treten auch an Stelle realer Gefahren und symbolisieren diese (Tyson & Tyson, 2009). So nähern sie sich neurotischen Ängsten an, die in der Adoleszenz, dem sich entwickelnden Erwachsenenalter (Staats & Taubner, 2015), dem Erwachsenenalter und dem Alter ihre individuellen und doch auch von biologischen und sozialen Faktoren stark beeinflussten Ausprägungen finden. Auf diese bei der Entwicklung einer Angststörung wichtigen entwicklungsbezogenen Auslöser und charakteristischen Bewältigungsformen kann hier nur verwiesen werden.
Folgerungen für die Praxis: Angststörungen und kindliche Ängste
Die geschilderten »kindlichen« Ängste und Verarbeitungsformen treten bei Angststörungen im späteren Lebensalter vielfach wieder auf (Benecke & Staats, 2017). Sie werden dann regressiv an Stelle einer Auseinandersetzung mit aktuellen ängstigenden Anforderungen mobilisiert und vertreten diese im bewussten Erleben. Die manifesten Inhalte der Angst vertreten dann Angst aufgrund unbewusster Konflikte oder aufgrund struktureller Einschränkungen (Band 1, Kap. 7.7). »Die neurotische Gefahr muss also erst gesucht werden« (Freud, 1926, S. 198).
Читать дальше