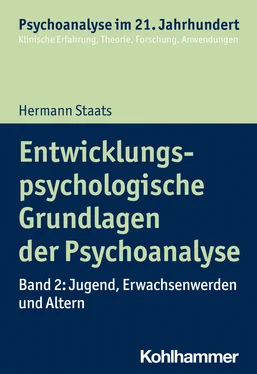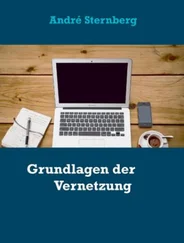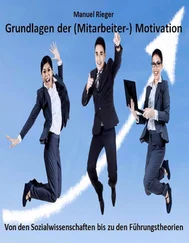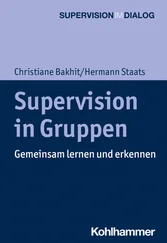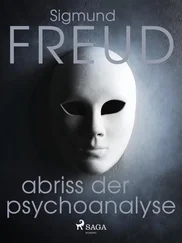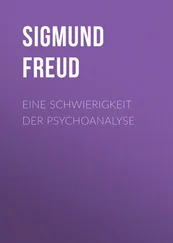Mit der Geburt eines weiteren Kindes innerhalb der Familie verändern sich die Rollen und werden neu verteilt. Typischerweise kümmern sich meist die Mütter um das Neugeborene. Die Väter übernehmen vermehrt alltägliche Aufgaben, kümmern sich um die Mutter sowie die gemeinsamen älteren Kinder. Für Eltern ist die Geburt des zweiten oder dritten Kindes ein Ereignis, das nicht so lebensverändernd ist wie die Geburt des ersten Kindes. Sie sind bereits mit den elterlichen Aufgaben und Kompetenzen vertraut; ihr erstes Kind hat sie bereits zu Eltern gemacht und auch in dieser Hinsicht »erzogen«. Für die Geschwister ist die Geburt eines weiteren Kindes in der Familie jedoch bedeutsam. Adler (1927) beschreibt die »Entthronung« für das erstgeborene Kind als ein traumatisches Ereignis, in der die Ursache für die Geschwisterrivalität liege. Aufgaben der Eltern liegen darin, den Kontakt zwischen den Geschwistern herzustellen, sie miteinander vertraut zu machen und allmählich den Aufbau einer Beziehung anzuleiten. Sie sollen all ihre Kinder versorgen und zufrieden stellen, möglichst ohne dass sich das ältere Geschwisterkind benachteiligt fühlt und dadurch die Rivalität verstärkt wird (Kasten, 1998, S. 91 f.). Rivalität zwischen Geschwistern bleibt aber in der Regel lebenslang ein Thema – von Kain und Abel an begleitet sie Entwicklungen, regt zu besonderen Leistungen an oder zerstört diese. Rivalität taucht im Lebenszyklus wiederholt und in unterschiedlicher Form auf (Beschreibung phasenspezifischer Herausforderungen und Konflikte bei Petri, 1994). Oft wird sie noch nach dem Tod der Eltern (z. B. in Fragen um das Erbe) wirkmächtig. Die existentielle Herausforderung des Umgehens mit der Ungerechtigkeit des Lebens, der Abschied von Wiedergutmachungsansprüchen und der Verzicht auf Rache werden in späteren Lebensphasen zum Thema.
Die Ankunft eines Geschwisterkindes führt zu progressiven und regressiven Entwicklungen der älteren Geschwister. Sie identifizieren sich mit dem Pflegeverhalten der Eltern (z. B. als »Beschützer« ihres kleinen Geschwisters) oder mit dem jüngeren Kind (und können dann auf frühere Entwicklungsstufen zurückgehen). Neid auf das Neugeborene kann verstärkt in den Vordergrund rücken und wird auf unterschiedliche Weise abgewehrt und bewältigt. Eine Spezialisierung der Kinder wird als »Nischenbildung« beschrieben. Geschwister suchen ihren Platz und entwickeln sich vor diesem Hintergrund unterschiedlich – wenn eine Position schon besetzt ist, suchen die neu dazugekommenen Geschwister nach anderen Rollen, um sich differenzieren zu können. Geschwister sind dadurch auch in ein- und derselben Familie unterschiedlichen Umwelten ausgesetzt – und sie schaffen sich mit einer Differenzierung weitere Unterschiede in der Art, wie sie ihre Familie erleben und von den Familienmitgliedern erlebt werden.
Freud hat betont, dass Geschwisterbeziehungen nicht notwendigerweise liebevoll zu sein brauchen. Sie bieten ein Übungsfeld für das Umgehen mit Ambivalenz. Wut, Neid, Ablehnung werden in einer Beziehung erlebt, die mit lebenslanger Verbundenheit einhergeht. Rivalität und Zugehörigkeit bestehen nicht trennbar nebeneinander – Geschwister sind Spielpartner und Rivalen. Ihre Rollen füreinander ändern sich im Lebenslauf. Sie sind Bindungspartner, Übergangsobjekte (Adam-Lauterbach, 2013) und wichtige Ressource der sozialen Unterstützung. Die Bedeutung der Geschwisterbeziehung folgt dabei in vielen Fällen einer U-Kurve mit viel Nähe in der Kindheit, eher wenig Nähe im jungen Erwachsenenalter und wieder mehr Nähe im Alter nach dem Auszug der eigenen Kinder. Schon sehr junge Kinder haben zeitlich etwa so viel Kontakt mit ihren Geschwistern wie mit ihren Eltern. Ab dem dritten Lebensjahr verbringen Geschwister mehr Zeit miteinander als mit ihren Müttern oder Vätern (Kasten, 1998). In der Gruppe der über 70 Jahre Alten haben in Deutschland 80 % der Menschen noch Geschwister, nur 45 % noch einen Ehepartner. Geschwister werden im Alter daher wieder Bezugspunkt und Ressource. Die Beziehung zwischen Geschwistern stellt die längste Beziehung dar, die ein Mensch zu einem anderen Menschen innehat. Kasten (1993) beschreibt eine tiefwurzelnde (oftmals uneingestandene) emotionale Ambivalenz mit dem gleichzeitigen Vorhandensein von intensiven positiven Gefühlen wie Liebe und Zuneigung und negativen Gefühle wie Ablehnung und Hass als Charakteristikum der Geschwisterbeziehungen. Darstellungen der Geschwisterbeziehungen aus psychoanalytischer Sicht finden sich bei Kasten (1993), Petri (1994) und Sohni (2004) und in den Sammelbändern der »Familientherapie« (2015, 16, Heft 30) und der »Psyche« (2017, 71, Heft 9/10).
Trotz dieser Arbeiten wird die Bedeutung von Geschwisterbeziehungen in den psychoanalytischen Theorien vergleichsweise wenig beachtet – am ehesten noch in der Literatur zu Gruppenanalyse und psychodynamischer Gruppenpsychotherapie (z. B. Staats, Bolm & Dally, 2014). In Gruppen kann gut beobachtet werden, wie Konflikte der Teilnehmer mit ihren Geschwistern in deren Ursprungsfamilie auf aktuelle Beziehungen in der Gruppe und auch auf Beziehungen der Kinder (der Gruppenteilnehmer) untereinander übertragen werden.
Beispiel:
Die als jüngstes Kind subjektiv in vielem »zu kurz« gekommene Mutter unterstützt immer wieder finanziell und emotional die jüngere, in ihrem Erleben zu kurz kommende Tochter; der als ältester Sohn geborene und gegenüber seinem jüngeren Bruder auf viel Aufmerksamkeit bedachte Vater fördert besonders den älteren Bruder über sein besonderes Interesse. Die Eltern bemühen sich bewusst um »Gerechtigkeit«. Die Rivalität der Geschwister wird durch das Verhalten der Eltern aber gesteigert. Beide fühlen sich benachteiligt. Die Geschwister erleben ihre Eltern als ganz unterschiedlich und brauchen ihre Zeit, um sich über ihre unterschiedlichen Erfahrungen und Elternbilder verständigen zu können und die Sicht des jeweils anderen als ebenfalls berechtigt wahrzunehmen.
Neben Gemeinsamkeiten, werden oft deutliche, betonte Unterschiede zwischen Geschwistern beschrieben. Diese auseinanderführenden Entwicklungen werden auf zwei verschiedene Vorgänge zurückgeführt. Einerseits sind Geschwister von Beginn an subjektiv unterschiedlichen Umwelten ausgesetzt. Sie entwickeln sich daher auch unterschiedlich. Interaktionen in der Familie hängen von ihrem genetisch angelegten Temperament ab und von einer Umwelt, die durch ihre Ankunft schon anders ist als die ihrer Geschwister. Andererseits schaffen sich Geschwister diese unterschiedlichen Umwelten und Nischen auch aktiv, um sich zu unterscheiden und mit unterschiedlichen Entwicklungswegen Rivalität zu moderieren. Diese »Deidentifikation« trägt dazu bei, dass miteinander aufwachsende Geschwister sich in einigen empirischen Studien stärker unterscheiden als getrennt aufwachsende Geschwister. Identifizierungen und Abgrenzungen innerhalb der Geschwisterreihe nehmen Einfluss auf unbewusste Beziehungsvorstellungen und Erwartungen. Die dort gemachten Erfahrungen werden übertragen – auf die eigenen Kinder, Freunde, Arbeitskollegen und Partner.
Zur Entwicklung sozialer Kompetenz tragen Geschwisterbeziehungen in vielfältiger Weise bei. Sie ermöglichen eine – im Verhältnis zu den Eltern anders gelagerte und leichter erreichbare – Perspektivübernahme und Triangulierung. Beziehungen zu Geschwistern unterscheiden sich aber auch von denen zu Eltern. Geschwister geben direktere Rückmeldung. Während Eltern in Auseinandersetzungen häufig nachgeben, bleiben Geschwister eher »stur«. Konflikte werden durchgestanden. Die Geschwister erziehen sich gegenseitig – »unter der Supervision der Eltern«. Die horizontalen Bindungen und Konflikte zwischen Geschwistern treten oft nach dem Tod der Eltern besonders deutlich hervor.
Diese – entwicklungsfördernde – Sicht auf Geschwisterbeziehungen wird aber auch hinterfragt. Aus psychoanalytischer Perspektive wird das Erleben von Neid und Rivalität als wichtig zur Abgrenzung und Ich-Entwicklung angesehen. Aus verhaltenstherapeutischer Sichtwerden dagegen häufige körperliche Gewalt und Ausschluss als eine Ursache späterer Schwierigkeiten im Erwachsenenleben beschrieben. Rivalität gelte es zu verhindern – nicht als eine normale Entwicklungsphase hinzunehmen (Witte et al., 2019). Die Autoren beschreiben in einer umfangreichen Befragung Erwachsener zu ihrem Erleben in der Kindheit, dass ein geringer Altersabstand zwischen Geschwistern mit verstärkten Konflikten und Feindseligkeit einhergeht. Eine höhere Anzahl der Geschwister war dagegen mit geringerer Feindseligkeit und geringerer Konflikthäufigkeit im Erwachsenenalter verbunden.
Читать дальше