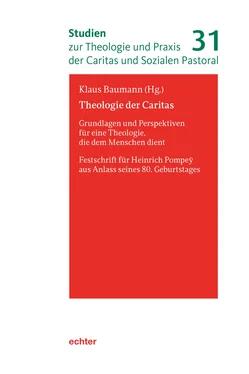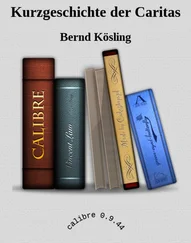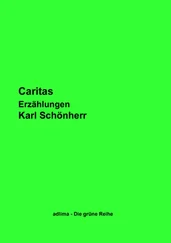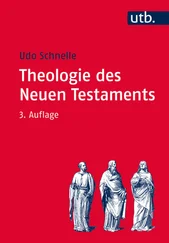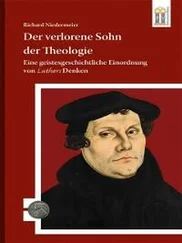Dazu gehört aber auch das Ringen um die entscheidenden Grundlagen und Perspektiven, von denen aus eine Theologie der Caritas auch für die Einrichtungen und Dienste der verbandlichen Caritas zu betreiben ist. Diesen Debatten mit meinem Doktorvater Rolf Zerfaß und seinen Schülern haben Sie sich immer gestellt und diese selbst engagiert geführt. Bei allen Unterschieden aber wäre es Ihnen nie in den Sinn gekommen, andere Meinungen und die dahinter stehenden Personen zu diffamieren. Sind doch gerade die Debatte und das Argumentieren notwendig, um im Sinne des Horizonts vom Reich Gottes eine Caritastheologie zu entwickeln. Denn „der Mensch ist der Weg der Kirche“ wie der Hl. Papst Johannes Paul II. sagte – und das gilt auch für die Theologie.
Wie notwendig eine theologische Durchdringung caritativer Arbeit und ihrer Grundlagen ist, zeigt sich dieser Tage für mich in der nach wie vor aktuellen Flüchtlingssituation. Selten hat ein Thema gesellschaftlich so stark polarisiert. Christlicher Einsatz für den Nächsten ist davon nicht ausgenommen. So wird beispielsweise die Rede vom christlichen Abendland dazu missbraucht, Menschen auszuschließen oder diejenigen zu diskreditieren, die sich für Flüchtlinge einsetzen. Gerade der christlich motivierten Flüchtlingshilfe wurde in den letzten Monaten immer wieder allein gesinnungsethisches und damit wirklichkeitsfremdes Handeln vorgeworfen. Dabei ist der häufig bemühte Gegensatz von Gesinnungs- und Verantwortungsethik letztlich ein Scheinwiderspruch, der Gefahr läuft, instrumentalisiert zu werden. Ist doch jedes Handeln von der Spannung zwischen Idealen und realen Konsequenzen geprägt. Und jede Übernahme von Verantwortung ist auf die Rückbindung an Werte und damit auf eine Gesinnung angewiesen. Eine polemische Unterscheidung zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik ist daher gerade bei diesem Thema völlig unangemessen, weil sie dazu benutzt wird, politisches Handeln von ethischen Anforderungen loszusprechen.
Eine Theologie der Caritas, die dem Menschen dient, muss sich also auf gesellschaftliche Diskussionen genauso einlassen wie auf theologische Debatten oder Fachdiskussionen im Bereich der Sozialen Arbeit.
Dafür, dass Sie lieber Herr Prof. Pompeÿ, dies immer wieder um Gottes und der Menschen willen bis heute tun, sei Ihnen persönlich und im Namen des Deutschen Caritasverbandes ausdrücklich gedankt. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Geburtstag und Gottes Segen!
1Am 24.11.2016 beim Empfang im Priesterseminar Collegium Borromaeum.
2 https://www.theol.uni-freiburg.de/disciplinae/ccs/fachprofil/geschichte1; Zugriff am 09.11.16.
Einleitung
Theologie der Caritas – ein verheißungsvolles offenes Arbeitsfeld
Klaus Baumann
Das Symposium zum 80. Geburtstag von Heinrich Pompeÿ trug wie diese Festschrift den Titel „Theologie der Caritas. Grundlagen und Perspektiven für eine Theologie, die dem Menschen dient“. Es bringt ein Herzensanliegen des Jubilars auf den Punkt. Die verschiedenen Beiträge zeigen Facetten eines offenen Arbeitsfeldes für die Theologie in ihren verschiedenen Teildisziplinen, angefangen von philosophischen Fragebereichen über die biblische, historische, systematische bis hin zur praktischen Theologie. „Caritas“ stellt ein stimulierendes Querschnittsthema für alle theologischen Disziplinen dar.
Die Caritaswissenschaft als eigene Disziplin ist selbst in der praktischen Theologie angesiedelt und bietet ein konsequent interdisziplinäres Selbstverständnis und Arbeitsprogramm. Dazu gehört die eigenständige Aufnahme unterschiedlichster philosophischer und theologischer Ansätze und Beiträge, ihre Weiterentwicklung und Vertiefung wie auch das Aufwerfen neuer Fragen und Perspektiven in kommunikativer Wechselwirkung mit den mannigfachen Gestalten der Verwirklichung der Sendung der Kirche in ihrer „Caritas“. Die Frage, was den Menschen dient, besonders „den Armen und Bedrängten aller Art“ ( Gaudium et spes [GS] 1), stellt das entscheidende erkenntnisleitende Interesse für die Caritaswissenschaft dar. Das gilt auch für ihr Interesse innerhalb der Theologie. Dieses erkenntnisleitende Interesse ist nicht diffus und vage, sondern wird im Licht und Geist der Person, Sendung und Botschaft Jesu Christi, kurz: des Christusereignisses, und in präziser Wahrnehmung von Armut und Not konkretisiert. Die Wahrnehmung von Armut und Not ist ganz im biblischen Sinne einer präferentiellen Option für die Armen empathischparteilich. Angesichts dieser Aussagen mag als Desiderat für diesen Band zu Recht das Fehlen eines biblisch-exegetischen Beitrages angemerkt werden.
„Theologie der Caritas“ stellt ein offenes Arbeitsfeld mit dem Bedarf vielfältiger Grundlagenforschung dar, interdisziplinär innerhalb der Theologie und gleichursprünglich inter- und transdisziplinär im Dialog mit den verschiedenen, je nach Fragestellung involvierten Bezugswissenschaften wie Soziale Arbeit und Rechtswissenschaften, Human- und Sozialwissenschaften, Medizin und Pflegewissenschaft, Wirtschafts- und Umweltwissenschaften. Die Beiträge dieses Bandes erheben nicht den Anspruch, das theologische Feld abzustecken oder gar abzuschreiten; sie alle wollen und können mit ihren jeweiligen Perspektiven und Akzenten jedoch „zu denken geben“ und weitere Vertiefungen und Diskussionen anregen. Heinrich Pompeÿ beginnt selbst damit und formuliert gegen Ende dieses Bandes „Resonanzen“, welche die einzelnen Beiträge in ihm ausgelöst haben. Mit Rücksicht auf diesen Resonanzraum des Jubilars gehe ich selbst in dieser Einleitung nicht näher auf die einzelnen Beiträge ein.
Papst Benedikt XVI. fasste die Sendung der Kirche am Ende seiner ersten Enzyklika „Deus caritas est“ (Dce) in die Kurzformel „Sendung im Dienst der Liebe“ (Dce 42). Zwar ist diese Enzyklika das erste lehramtliche Dokument solchen Ranges mit genau diesem thematischen Fokus. Sie hat jedoch ihre Vorgeschichte – unmittelbar im Kontext der Vorarbeiten, Entwicklungen und Hindernisse, die Paul Josef Kardinal Cordes mit seiner intimen Kenntnis der Etappen und Vorgänge aufgrund seines Wirkens als damaliger Präsident des Päpstlichen Rates Cor unum in diesem Band detailliert darlegt. 1
Mittelbar liegt die Vorgeschichte der Enzyklika in den Entwicklungen organisierter Caritas-Arbeit besonders seit dem 19. Jahrhundert und der bald erkannten Notwendigkeit, die Lebendigkeit des Einsatzes zusammen mit der fachlichen Kompetenz von ihren theologisch-spirituellen Wurzeln her zu schützen und zu fördern. Das Erkennen dieser Notwendigkeit wurde zum entscheidenden Impuls für die Gründung des Instituts für Caritaswissenschaft an der Theologischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg am 03.04.1925 2auf Initiative und mit Unterstützung des Deutschen Caritasverbandes durch ihren damaligen Präsidenten Benedict Kreutz (1879-1949) 3. Auf evangelischer Seite folgte zwei Jahre später die Gründung des „Berliner Instituts für Sozialethik und Wissenschaft der Inneren Mission“ 4. Beide universitären Institute wurden wegen ihres offenkundigen Widerspruchs zur NS-Volkswohlfahrt 1938 von der NS-Regierung aufgehoben bzw. unterdrückt. Beide wurden nach dem II. Weltkrieg wieder errichtet, das Institut in Freiburg schrittweise schon ab 1945, während das Berliner Institut nach einem längeren Klärungsprozess 1954 seinen Nachfolger im Diakoniewissenschaftlichen Institut an der Universität Heidelberg fand.
Die Notwendigkeit, die Lebendigkeit und Qualität der Caritas-Arbeit von ihren theologisch-spirituellen Wurzeln her zu schützen und zu fördern, wurde mit dem gesellschaftlichen Wandel und Wachstum in den Feldern der Sozialen Arbeit und der Gesundheitsversorgung in und nach dem II. Weltkrieg bis heute nicht geringer, im Gegenteil. 5Wie dies heute und morgen aber geeignet geschehen kann, ist eine offene Frage und Herausforderung 6zumal unter den „flüchtigen“ 7Bedingungen, Möglichkeiten und Zwängen einer (post- oder spät-) modernen, pluralen und säkularen Gesellschaft, zu der die Gläubigen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Hilfesuchenden, die Kirche und ihre Caritas auf je ihre Weise selbst gehören. In keinen anderen als mitten in diesen Bedingungen, Möglichkeiten und Herausforderungen des „Heute“ hat die Kirche ihre Sendung als Diakonie zu leben. 8
Читать дальше