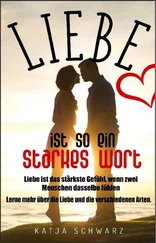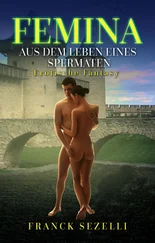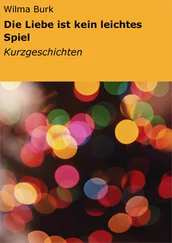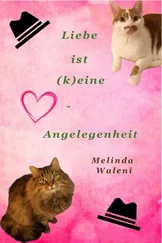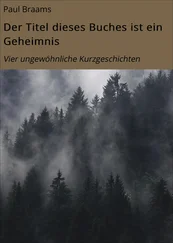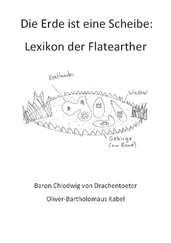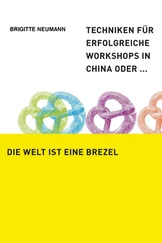1 ...7 8 9 11 12 13 ...16 «Ein drolliges Ehepaar waren wir», erzählt Bettina Hürlimann in der Festschrift zu Martin Hürlimanns 70. Geburtstag, «denn der Verlag und die Zeitschrift Atlantis nahmen in unserem Leben neben den Kindern den grössten Raum ein». Familie und Verlag im gleichen Haus – da gab es auch «im persönlichen Leben fast nichts», was nicht mit dem Verlag zu tun hatte. «Unsere besten Freunde waren auch unsere Mitarbeiter. Wenn wir Silvester feierten, so waren alle Atlantiden versammelt, und der Vulkan, auf dem wir zwischen 1933 und 1939 sassen, war für Stunden vergessen.» Ein Bund mit Wermutstropfen, denn «der unermüdliche Verleger, Redaktor, Journalist und Photograph M. H. hat mir mein Leben lang den Menschen M. gestohlen. Nur dadurch, dass er mich ganz und gar voll dauernden Vertrauens in sein Berufsleben hineinnahm, wie es wohl selten in einer Ehe geschieht, versöhnte er mich mit dieser Tatsache und liess mich glücklich sein, förderte mich und machte mich zu dem, was ich bin».
Ein Arbeitspaar? Ein Paar für das Werk? Aus romantischer Sicht kann man fragen: Muss man ein Paar sein, um famos zusammenzuarbeiten? Manchmal schon. Bettina wollte mit Kopf und Herz und Hand stets eines: Verlegerin sein. Nicht bloss als Verlegerin arbeiten. Verlegerin sein. Sie sah darin ihre persönliche Bestform. Mit M. schaffte sie das. In einer Bücherwelt aufgewachsen, ahnte sie auch den Preis dieses Lebenstraums. Ihr Vater war der bedeutende Verleger Gustav Kiepenheuer. Und M.? Er bekam ungleich mehr als eine tüchtige Mitarbeiterin – eine masslos interessierte, ideenreiche, humorvolle Partnerin. Sie bereicherten gegenseitig ihr Dasein. Sie arbeiteten nicht nur zusammen, sie machten einander wechselweise besser. Die Ehe als Verwandlung – zu sich selbst.
Am 19. Juni 1909 kam sie in der Dichterstadt Weimar zur Welt. Bettina? «Ach wie reizend, wie Bettina Brentano, die Goethefreundin!» Später bewirkte die berühmte Namensvetterin gar «eine gewisse Identifikation im Geiste». Ihr Vater, Gustav Kiepenheuer, der Buchhändler, hatte hier 1908 eine Buch-, Kunst- und Musikhandlung übernommen und ein Jahr später einen Verlag gegründet. In diesem Reich mit Bücherregalen bis an die Decke erstieg Bettina die Leiter und schnupperte an den Werken, «die einen Geruch ausströmten, den nur gute Bücher haben, aus gutem Papier, mit Lederrücken und guter Farbe gedruckt». Immer musste sie an einem Buch zuerst riechen, bevor sie es aufschlug. Sie spürte bereits etwas vom Verlegerberuf, «der so besitzergreifend ist, dass er den Kindern nicht nur die Zeit, sondern auch manchmal das Herz des Vaters stiehlt». Den Papa beschrieb sie als «klein, blond, blauäugig, zierlich, später rundlich». Ein Auge war aus Glas, ebenso blau wie das andere. Dachte sie an ihn, sah sie ihn «eher beschaulich, rauchend im tiefen Ledersessel» – die Mutter Irmgard hingegen als «hochdramatische Vorleserin, gross, schlank, ausserordentlich elegant, dunkelhaarig, dunkeläugig, beweglich, aktiv». Bei «allen sozialistischen und sonstigen idealistischen Vorstellungen, die mit Macht in ihr Leben eindrangen», verleugnete sie «ihre grossbürgerliche Herkunft» nicht und gab «ihre Fähigkeit zu rechnen» nicht auf. «Irmchen» wollte sie genannt sein, die Tochter von Pastor Otto Funcke aus Bremen, einem der erfolgreichsten christlichen Volkserzähler des 19. Jahrhunderts. In der Erziehung, auch in der religiösen, herrschte im Haus Kiepenheuer denn auch nach wie vor die Pfarrerstochter.
1918 zog die Familie nach Potsdam, der alten Residenzstadt Preussens, in eine bürgerlich-altmodische Wohnung. Die Annehmlichkeit eines Hauses ersetzten ein kleines und ein grosses Hausboot. Dazwischen schaukelten ein Ruderboot, ein Kanu, ein Punt, zwei Segelboote und ein unsinkbares Ruderboot für die Kinder. Der Vater lehrte Bettina rudern, bevor sie richtig schwimmen konnte. «Das Havelufer mit den Booten war der … fast hochstaplerische Luxus unserer Kindheit. Es ersetzte Ferienreisen und half uns schutzlose Einsamkeiten zu bestehen. Nie hatten wir Geld und galten doch wegen der Boote und der Eleganz unserer Mutter als reiche Leute. Die Autoren aber erhielten das Letzte von meinem Vater. Das wusste ich.» Die Trennung der Eltern 1921, die Trennung vom geliebten Vater, war schmerzlich für die Zwölfjährige. Mit den jüngeren Brüdern, Karlotto und Wolfgang, «Wölfchen» genannt, lebte sie bei der Mutter. Diese gründete zusammen mit Hans Müller den «Müller & I. Kiepenheuer Verlag», edierte illustrierte Luxuswerke und schön gedruckte Klassikerausgaben, die Verlag und Familie über Wasser hielten. An Papier mangelte es nie. Als Tagebuch beschrieb Bettina Blindbände von Goethes Werken, die gerade vorbereitet wurden. «Bei uns war gestern ein grosser Musikabend mit 60 Leuten in unserer kleinen Wohnung. Thea van Doesburg spielte Klavier, Kurt Schwitters erzählte sehr niedliche eigene Märchen und trug eine ‹Sonate in Urlauten› vor, wovon ich den Sinn nicht ganz verstand. Hinterher war noch ein Ball, und ich tanzte zum erstenmal mit Erwachsenen.»
Befreundet mit dem Architekten Ludwig Mies van der Rohe beauftragte Irmgard Kiepenheuer diesen mit einem Hausbau auf dem Grundstück, auf dem die beiden Hausboote einst verankert lagen. Die Pläne waren gezeichnet, die Steine geliefert, allein das Geld fehlte. Bettinas frühester Berufswunsch war Architekt; die Abenteuer um den gescheiterten Hausbau gehörten deshalb zu ihren lebhaftesten Erinnerungen. Irmgard fand für Verlag und Familie die «Fasanerie», einen klassizistischen Bau mit Turm aus dem Besitz der kaiserlichen Familie, erbaut vom Schinkel-Schüler Ludwig Persius, etwas verkommen, am Rand des prächtigen Sanssouci-Parks. Die gotischen Ställe beherbergten keine Fasane mehr. Aber drinnen wie draussen: fantastische Welten für Bettina und ihre Brüder. «Ich kannte unsere Drucker, interessierte mich brennend für die Autoren und knüpfte … Beziehungen zu denen, die ich besonders schätzte oder gar verehrte.» Wilhelm Furtwängler wohnte hier. Walther Meier aus Wädenswil belegte ein Arbeitszimmer. Er hatte in Berlin den Zürcher Orell Füssli Verlag vertreten, traf später in der U-Bahn zufällig Martin Hürlimann, den Freund aus dem Militärdienst, der ihm daraufhin die Redaktion der Zeitschrift Atlantis anbot. Auf zahlreichen Spaziergängen im Park brachte dieser ungeheuer gebildete Mann, der mitreissend erzählen konnte, der Gymnasiastin «alles nahe […] unter der moderneren Dichtung, was er zur Weltliteratur zählte».
Beziehungen knüpfen, Freundschaften pflegen, das konnte Bettina. Etwa mit Gertrud Jakstein, der Zeichenlehrerin. «Meine malerischen Produkte, obgleich ich zeitweise unbewusst dem Maler Nolde nacheiferte, waren das Eigenständigste, was ich damals produzierte. Ich war beim Malen ausserordentlich glücklich.» Jakstein ermutigte ihre Schülerinnen, Neues zu wagen, ein Marionettentheater zu bauen und aufzutreten. Bettina, hingerissen von Kleists Essay über die Marionetten und vom eigenen Spiel, war fest entschlossen, auch dieser Kunst nachzugehen. Sie hatte die Gabe, «mehr und tiefer zu sehen als andere», erinnerte sich ihre lebenslange Freundin Inge Bolle; sie habe Freundschaften geradezu gesammelt, sei spontan auf Menschen zugegangen, die ihr gefielen, ob ein Gärtner im Park Sanssouci, ein Verlagsautor oder eine einsame Frau. Befreundet war Bettina auch mit der Familie des jüdischen Bankiers Louis Hagen, eines grosszügigen Mäzens, «kulturbesessen auf vergnügliche Art». Irmgard war eine strenge Erzieherin. Beruflich oft auf Reisen, wollte sie sich auf die Kinder verlassen können. «Ich betete diese Mutter an, weil ich sie bewunderte und mich zudem nach Anlehnung und Vertrauen sehnte.» Vergeblich. Zu problembeladen, urteilte Bettina über sich, und nicht so attraktiv, wie die Mutter sich ihre einzige Tochter vielleicht vorgestellt hatte. Äusserlichkeiten waren Bettina egal; «vielleicht machte ich auch aus der Not eine Tugend, weil mir die Möglichkeiten, mich schön zu machen, fehlten». Eine solide Verbindung blieben die Bücher aus Mutters Verlag. So entstand ein Verhältnis, das ein Gemisch war «von starker Bindung an das alte Haus und allem, was sich darin abspielte, und einer Protesthaltung gegen eben dieses Haus und die Mutter».
Читать дальше