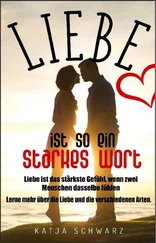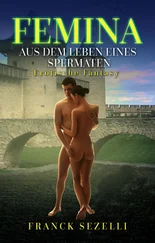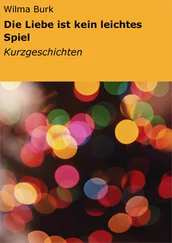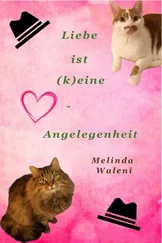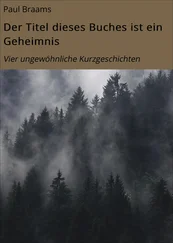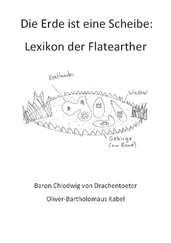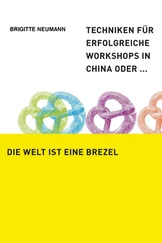Bettina las, schrieb Gedichte, studierte die Weltkunst, malte, zeichnete – und war bitter enttäuscht, als ihre Arbeiten für einen Platz in der Malklasse der Leipziger Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe nicht reichten. Also Schriftsetzer. Für ein Mädchen war diese Ausbildung 1929 nicht selbstverständlich. Erstklassige Fachleute lehrten in Leipzig alle grafischen Techniken. In der Akademie, damals europaweit die einzige Schule dieser Art, traf sich eine internationale Schülerschaft.
«Sehen Sie sich in der Welt um – und kommen Sie wieder.» Martin Hürlimanns Rat klingt nach. Eric Walter White, der Freund und Dichter aus dem Gymnasium, dank dem sie in Englisch brillierte, vermittelt ihr die Stelle als Privatlehrerin für seinen Bruder, der an Kinderlähmung erkrankt ist. Einen Monat nach ihrem Besuch im Atlantis Verlag reist Bettina Kiepenheuer also nach Bristol. Mit ihrer Fachliteratur, den liebsten Gedichtbüchern und einem Bündel Kleider im Strohköfferchen zwängt sie sich in den Drittklasswagen. Irmgard Kiepenheuer lässt die Tochter ziehen: Wenn sie schon keine gute Hausfrau werden wolle, solle sie wenigstens perfekt Englisch lernen. Bettina wohnt in Erics Elternhaus, dann bei Freunden, arbeitet halbtags in der Druckerei von Henry Hill, lernt Eric Gill, den Bildhauer, Illustrator und Schriftschneider, und Stanley Morison, «den lieben Gott der Schriftkunst», kennen. Die beiden stellen ihre relativ kurze Ausbildung «auf sichere Füsse». Auch in England herrscht Arbeitslosigkeit; ihr Antrag, die Stelle bei Henry Hill zu legalisieren, wird abgelehnt, innert drei Tagen muss sie das Land verlassen. So steht sie nach einem kurzen Englandjahr wieder auf dem Bahnsteig in Berlin, einen zusätzlichen Koffer in der Hand, gefüllt mit bibliophilen Büchern und einem ersten Abendkleid. «Niemand nahm gross Notiz davon, dass meine Welt um so viel bereichert und dass ich ein anderer Mensch geworden war.» Von ihrem Vater weiss sie, dass es allen Verlegern schlecht geht. Sie beginnt, Stenografie und Schreibmaschinenschreiben zu lernen, um ja nicht im Haushalt eingesetzt zu werden – und klopft «zagenden Herzens» ein zweites Mal beim Atlantis Verlag an, wo ihr Freund Walther Meier Lektor und Redaktor ist. Der Mann, der dann ihr Chef wird, «war ein eingefleischter, ja überzeugter Junggeselle und zwölf Jahre älter als ich. Er war ausserdem der einzige Mensch in meiner Umgebung, dem in jenen Jahren vor Hitlers Machtergreifung das Wasser nicht in irgendeiner Weise bis zum Halse stand. Ein sagenhaftes Zürich stellt da geistig und materiell einen beneidenswerten Hintergrund dar. Davon hatte ich aber keine Ahnung».
Sagenhaftes Zürich? Die schlossähnliche Villa auf dem Hügel, die blühende Brauerei, die dominante Mutter, der mächtige Vater, die weit verzweigte Familie, die legendäre Weihnachtsfeier? Martin Hürlimann, am 12. November 1897 geboren, hat noch die Friedenszeit vor 1914 erlebt, Kaiser Wilhelm II. die Zürcher Bahnhofstrasse hinauffahren sehen, das letzte Jahr der Grenzbesetzung 1914–1918 als Soldat mitgemacht und seither «an der nicht mehr abbrechenden Weltkrise teilgenommen». Gemäss der Familientradition hätte er Offizier werden sollen, er blieb aber Korporal. «Ich war Pazifist, glaube es auch heute noch zu sein, wenn mir auch bewusst ist, dass ich den heutigen Pächtern dieses Begriffs längst nicht genügen kann.» Die Mutter, Bertha Hürlimann-Hirzel, kam aus einer alten Stadtzürcher Familie, sie war eine starke Persönlichkeit, der Vater, Albert Heinrich Hürlimann, dritter Spross der Brauerdynastie, ein fürsorglicher, persönlich anspruchsloser Patriarch. Wieso er ein Jahr nach Martins Geburt auf einem der höchsten Punkte des Enge-Quartiers den prunkvollen «Sihlberg» mit der «herausfordernden Fassade» und den zwei Türmen bauen liess, konnte der Sohn nie ganz verstehen. Da gab es ein Wäldchen und einen Rebberg, einen Springbrunnen mit Bronzetieren, einen Hühnerhof und einen Gemüsegarten, der später einem Tennisplatz weichen musste. In der Nachbarschaft lagen die Güter der Bodmers und Landolts.
Hier wuchs Martin mit der jüngeren Esther und je zwei älteren Schwestern und Brüdern auf. Mit Gärtner, Hausknecht, Köchin, Stubenmädchen – «an dienenden Geistern war damals kein Mangel, die meisten gehörten Jahrzehnte zu uns». Am Esstisch herrschte strikte Ordnung: «Oben präsidierte der Vater, ihm zur Seite, mit Blick gegen die Officetür, dirigierte die Mutter. Die Sitzordnung folgte, auch als wir Geschwister später mit unseren Ehegatten einkehrten, stets der Rangordnung des Alters.» Abends durften die Kinder erst nach der Konfirmation am Familientisch essen. Die Sprösslinge erkundeten sonntags die Lagerkeller, stiegen in die Silos, knabberten Malz, besuchten die sechzig Pferde in den Stallungen, die schweren Belgier der Bierfuhrwerke und die eleganten Reitpferde, «die beiden Fuchse für die Equipage, mit der Mama zu Einkäufen und Besuchen in die Stadt zu fahren pflegte». Die Eltern verbanden in besonderer Weise «Traditionsbewusstsein mit offenem Sinn für die weite Welt», bereisten Anfang des 20. Jahrhunderts Ceylon und Indien, Japan – und kehrten von dort mit der Transsibirischen Eisenbahn via Moskau zurück. Die Sommerferien verbrachte die Familie in den Bergen oder am Meer.
Weihnachten, «Höhepunkt der ‹ewigen Zeit›, der einzige Tag, an dem der Salon mit seiner Rokokopracht … sich richtig belebte». Am späten Nachmittag an einem der Festtage versammelte sich die immer grösser werdende Familie – einige Jahre nach dem jüngsten Kind war auch schon der erste Enkel da – jeweils im «Boudoir». «Es wurden Verse aufgesagt, die neuesten Fertigkeiten auf dem Klavier, der Flöte oder der Geige produziert, bis dann der grosse Moment kam, die Flügeltür zum Salon sich öffnete und der mächtige Baum in seinem Lichterglanz vor uns stand. Hatte das Stubenmädchen aus Versehen die Rollläden hinuntergelassen, mussten sie schleunigst wieder hochgezogen werden: Weihnachten feierte man nicht im Verborgenen.»
Martin Hürlimann erinnert sich auch an frühe Demütigungen: Der Knirps, der noch in die Hosen machte, musste Mädchenröckchen oder die rauen Schandhosen anziehen. Für andere Vergehen wurde er eine Stunde lang in «die Kiste» verbannt, «eine Art transportabler Holzkerker», etwa doppelt so hoch wie der kleine Tunichtgut. Peinlich war ihm, von der Mama in extravagante Kleider gesteckt zu werden, einen Hut oder Anzug tragen zu müssen, den sie aus Paris oder London mitgebracht hatte. Als Sohn der Familie Hürlimann war er ohnehin abgestempelt und blieb es noch lange – «aha, einer von der Brauerei, Brauereibarone». Der Primarschule in der Enge folgte ein Zickzackweg zur Matura: Kantonsschule Zürich, Lyceum Alpinum Zuoz, ein halbes Jahr Privatunterricht im «Sihlberg», zurück an die Kantonsschule Zürich – kaum eingewöhnt, war wieder Schluss. Zu fabrikmässig, zu viele gesellschaftliche Anlässe und andere Ablenkungen, fanden die Eltern und schickten den Knaben in die Kantonsschule Frauenfeld. Dort schlug Martin endlich Wurzeln und fand Kameraden, dank denen er sich «in die Gesellschaft ausserhalb der Familie» integrieren konnte. Für den Maturaaufsatz wählte er als Einziger das Goethe-Zitat: «In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.» Tanzkurse gehörten zur Bildung. An privaten Bällen wurde geübt. «Der Wettbewerb um die jungen Schönen brachte eine geheimnisvolle Erwartung in den Alltag, öffnete den ersten Spalt ins Reich des Eros. Man trug weisse Handschuhe, um nicht mit feuchten Händen an den duftigen Kleidern und den weissen Armen herumzutappen, und noch spüre ich den leisen Duft von Puder, Schweiss und Mädchen …»
Im Frühjahr 1917 immatrikulierte sich Martin Hürlimann an der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich, studierte 1920 in Leipzig weiter und fand im Institut für Kultur- und Universalgeschichte, dem ersten von der Universität unabhängigen deutschen Forschungsinstitut, genau das, was ihm vorschwebte: «Geschichte nicht als Spezialwissenschaft, sondern als Gesamtschau einer in ständiger Evolution befindlichen Vergangenheit mit all ihren politisch-militärischen, aber auch ihren kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen Komponenten und deren Wechselwirkung.» Die Arbeit an seiner Dissertation, «Die Aufklärung in Zürich. Die Entwicklung des Zürcher Protestantismus im 18. Jahrhundert», unterbrach er 1922/23 zugunsten einer Weltreise mit dem viereinhalb Jahre älteren Bruder Heinrich. Höhepunkt war der Aufenthalt in China. «Tut Kung Bluff. Das unvermeidliche Buch eines Weltreisenden» war rasch geschrieben. «Wir sind jung», erklärte Martin Hürlimann im Vorwort, «deshalb haben wir das schöne Recht, zu irren. Ich habe die Welt eigenwillig gesehen und will sie euch eigenwillig zeigen. Die Welt ist mannigfaltig und voller Widersprüche. Meine Erzählung wird mannigfaltig und voller Widersprüche sein. So wie mich das Erlebnis hin und her geworfen hat, wie es mich begeistert und abgestossen hat, will ich euch auch berichten. […] Im Zufälligsten möchte ich das Wesentliche erfassen, das, was uns selber etwas zu sagen hat – denn ich dachte in letzter Linie doch immer an mich und an euch zu Hause». Seine Unbefangenheit kam ihm dann später ebenso genierlich wie beneidenswert vor.
Читать дальше