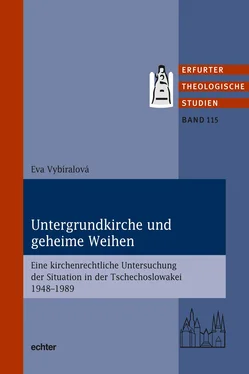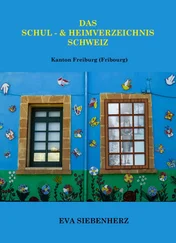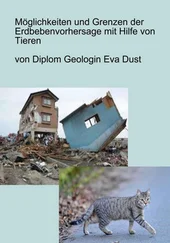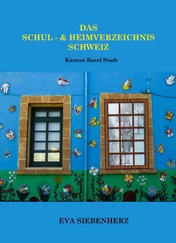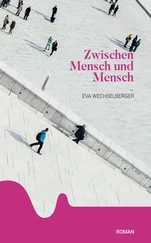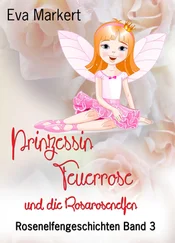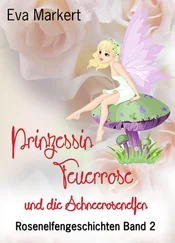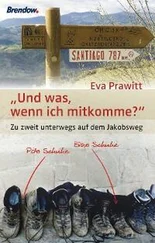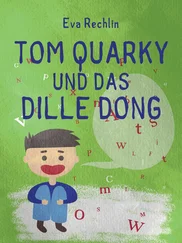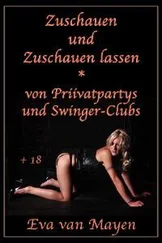1 ...8 9 10 12 13 14 ...20 Diplomarbeiten: Blaha, Karel, Žena jako kněz. Zkušenost Koinótés, Diplomarbeit an der HTF UK, Praha 2005. Kahounová, Miloslava, Život a odkaz biskupa Ladislava Hlada, Diplomarbeit an der KTF UK, Praha 2001. Sadílek, Jakub František, Studium teologie v české františkánské provincii (sonda do dějin české teologie) , Diplomarbeit an der KTF UK, Praha 2000.
Dissertationen: Sepp, Peter, Geheime Weihen. Die Frauen in der verborgenen tschechoslowakischen Kirche Koinótēs, Ostfildern 2004. Preunkert-Skálová, Petra, „Die ganze Welt schaut zu, wie sie uns um Gott betrügen“ Ekklesiologie und Pastoral der tschechischen Untergrundkirche, Ostfildern 2016. Nedorostek, Miroslav, „Moravská“ skrytá církev, Dissertation an der FHS UK, Praha 2017. Usw.
10 Bačíková, Lucia, Poď a nasleduj ma! Zo spomienok tajne vysvätených kňazov, Prešov 2005. Konzal, Jan, Duch a nevěsta. Z dějin církevního podzemí ve 2. polovině 20. století, Brno 2010. Hirka, Ján , Pod ochranou Márie. Pastier v službe Cirkvi, Prešov 2013. Beránek, Josef/Rybář, Jan, Deník venkovského faráře. Hovory s Janem Rybářem, Praha 2016. Usw.
11 https://www.getsemany.cz/archiv(abgerufen am 18.5.2017).
12 Bitterli, Marius Johannes, Wer darf zum Priester geweiht werden? Eine Untersuchung der kanonischen Normen zur Eignungsprüfung des Weihekandidaten, Essen 2010. Woestman, William H., The Sacrament of Orders and the Clerical State. A Commentary on the Code of Canon Law, 3. Auflage, Ottawa 2006.
13 Němec, Damián, Mimořádná kanonická opatření pro pokračování řeholního života v letech 19481989, in: Hanuš, Jiří /Mačala, Pavol /Marek, Pavel (ed.), Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, Brno 2010, 573-594.
14 Der in der deutschen Sprache fest eingewurzelte Terminus „Rituswechsel“ ist nicht präzis. Die beiden in der katholischen Kirche heute geltenden Codices verwenden den Begriff „Übertritt in eine andere eingenberechtigte Kirche (Kirche sui iuris)“, siehe c. 112 CIC/1983 und c. 32 CCEO.
15 Adam, Miroslav Konstanc , L’ascrizione ad una determinata Chiesa sui iuris e passaggio da una Chiesa sui uiris ad un’altra in Cecoslovacchia (1918-1990), in: Angelicum 88 (3/2011) 773-799.
16 Aufgrund der unterschiedlichen Schreibweise des Begriffs “sub condicione ” (vgl. CIC/1983) bzw. „sub conditione“ (vgl. CIC/1917; lat. Normae 1992) ist für diese Arbeit ein einheitlicher Begriff zu finden, um Missverständnisse zu vermeiden. Langenscheidt führt in seinem lateinischen Wörterbuch den Begriff „conditio, onis f“ als falsche Schreibweise für „condicio, onis f“ an. Demnach wird im Folgenden die Schreibweise aus dem CIC/1983 verwendet. Vgl. Menge, Hermann , Langenscheidt Taschenwörterbuch Latein-Deutsch, 9. Auglage, Berlin [u. a.] 2006, 119.
17 Den Kontakt vermittelte mir Dr. Petra Preunkert-Skálová, bei der ich mich recht herzlich bedanken will.
18 Für den Hinweis und die Möglichkeit der Einsichtnahme des Archivmaterials bin ich der Kanzlerin JUDr. Ing. Marie Kolářová, Th.D. zu Dank verpflichtet.
19 Eine vollständigere Liste der geheim Geweihten ist für die tschechische Übersetzung dieser Studie geplant.
1. DAS WEIHERECHT 20
Das Sakrament der Weihe (sacramentum ordinis) ist eines der sieben Sakramente der Kirche. Die Weihe (ordinatio) drückt, ebenso wie Taufe und Firmung, ein unauslöschliches Prägemal (character indelebilis) ein, weshalb sie, wenn sie einmal gültig gespendet wurde, nicht wiederholt werden kann.
Der Begriff ordinatio leitet sich vom lateinischen ordo ab, womit ursprünglich die Ordnung oder der privilegierte Sozialstatus im Römischen Reich bezeichnet wurde. Diejenigen, die zum ordo gehörten, wurden von den einfachen Bürgern (status) unterschieden. Auf die Kirche übertragen bedeutet dies, dass Personen, die durch Weihe zum ordo ( clericalis ) gehören, Glieder des Klerikerstandes sind und von solchen, die aus den Reihen des Laienstandes stammen, unterschieden werden. In der alten Kirche der ersten Jahrhunderte gehörten zum Presbyterium nicht nur die Ordinierten, sondern auch die Charismatiker, Asketen, Märtyrer und einige Frauen. Alle diese Personen hatten einen ausgezeichneten Sitz beim Gottesdienst. Später erfolgte die Aufnahme in den Klerikerstand meist nur durch Erteilung der Tonsur. Die Bezeichnung ordinatio galt für alle Weihestufen. Eine Ausnahme davon bildet die Bischofsweihe, die ebenfalls als consecratio (Bischofskonsekration) bezeichnet wird. Dieses Wort ist jedoch problematisch, weil es ebenfalls mit dem geweihten Leben verbunden ist – vita consecrata, consecratio virginum – und heute ebenso im Zusammenhang mit der Weihe der heiligen Öle, Hostien, Chrisam, früher noch mit der Kirchenweihe, Altarweihe oder Glockenweihe Anwendung fand. Für solche Handlungen, die Sakramentalien genannt werden, gibt es neben dem Begriff consecratio noch weitere Begriffe wie benedictio oder dedicatio.
Das Verständnis des Weihesakramentes bildete sich sehr langsam heraus. Viele theologische und kanonistische (Fach-) Begriffe entstanden erst in der Scholastik. Bis zum 20. Jahrhundert waren viele Einzelheiten zum Weihesakrament vom kirchlichen Lehramt nicht geklärt (Sakramentalität der einzelnen ordines) oder wurden im 20. Jahrhundert geändert (Abschaffung der Tonsur, der niederen Weihen und des Subdiakonates, Bestimmungen zu Materie und Form des Weihesakramentes, mehrmalige Änderung der Weihegebete usw.). Das Weihesakrament erfuhr im Vergleich zu den anderen Sakramenten während seiner Geschichte vielleicht die größten Umwandlungen. Deswegen ist die rechtsgeschichtliche Entwicklung des Sakramentes der Weihe von großem Interesse.
Behandelt werden in diesem Kapitel besonders jene Weihestufen, die nach heutigem Verständnis sakramental sind und zum Weihesakrament gehören – und zwar die Diakonen-, Priester- und Bischofsweihe. Jedoch auch die nichtsakramentalen Weihestufen sind für das Thema von Bedeutung, zum einen, weil sie zum Weihesakrament gehörten, zum anderen, weil die Linie zwischen den sakramentalen und den nichtsakramentalen Weihestufen nie eindeutig verlief. Die Tonsur stand außerdem an der Schwelle zum Eintritt in den Klerikerstand, wo heute das Diakonat zu finden ist.
1.1 Weihestufen
Die tridentinische Gliederung der Weihen wurde in das erste kirchliche Gesetzbuch Codex iuris canonici von 1917 übernommen. C. 949 unterscheidet die heiligen oder höheren Weihen ( maiores ) – Presbyterat, Diakonat, Subdiakonat – von den niederen Weihestufen (minores) – Akolythat, Exorzistat, Lektorat und Ostiariat. Nach c. 950 versteht man im Kirchenrecht unter den Begriffen ‘ (sacra) ordinatio’, ‘ordinare’ neben den genannten Weihestufen noch die Bischofsweihe und die erste Tonsur, 21wobei man Kleriker wird durch den Empfang der ersten Tonsur (c. 108). Jeder Kleriker muss entweder in einer Diözese oder in einer Religiosengemeinschaft inkardiniert werden (c. 111 § 1), was durch den Empfang der ersten Tonsur erfolgt (§ 2). Es ist verboten, eine Weihestufe zu überspringen (sog. ordinatio per saltum, c. 977)
Durch das Zweite Vatikanische Konzil wurden drei Weihestufen - Episkopat, Presbyterat und Diakonat - als zur hierarchischen Verfassung der Kirche gehörend erklärt. Obwohl noch im Jahre 1957 Papst Pius XII. die Idee des ständigen Diakonates für „ noch nicht reif “ erklärte 22, veranlasste wenige Jahre später das Konzil trotz einer innerkirchlichen Oppositionsgruppe (Kard. Ottaviani) 23das Wiederaufleben des Diakonats als eine eigene Weihestufe durch die Einführung des ständigen Diakonats für geeignete im Zölibat lebende Männer 24und (hauptsächlich) für verheiratete Männer (LG 29). Die Entscheidung vieler Konzilsväter war maßgeblich von dem beobachteten wachsenden Priestermangel geprägt, welchem man durch Diakonenweihe verheirateter Männer abhelfen wollte. Die zuständigen Bischofskonferenzen sollen nach LG 29 entscheiden, ob die Einführung des ständigen Diakonats für ihr Gebiet angebracht sei. Der Wunsch des Zweiten Vatikanischen Konzils nach Wiederbelebung des ständigen Diakonats fand mit dem Motu Proprio Sacrum diaconatus ordinem vom 18. Juni 1967 25Pauls VI. eine konkretere Gestalt.
Читать дальше