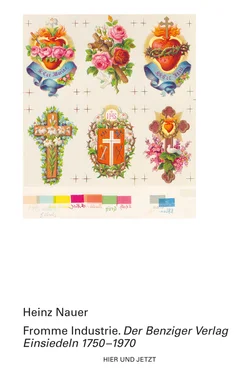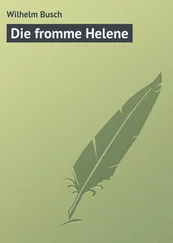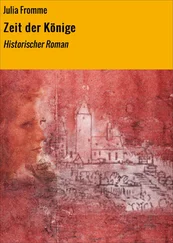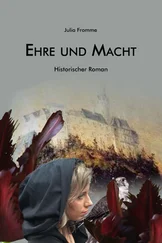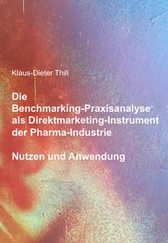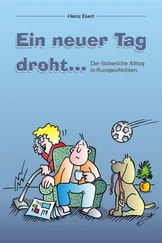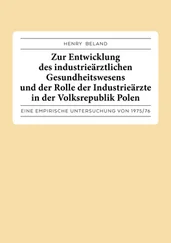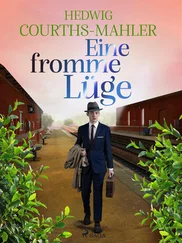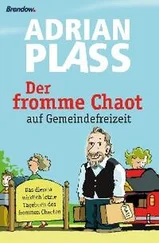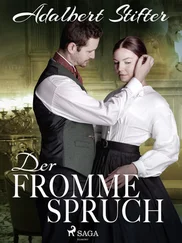Der französische Islamwissenschaftler und Religionshistoriker Olivier Roy wendet sich in seinem Buch «La Sainte Ignorance» (2008) 18– in diesem Punkt Hellemans nicht unähnlich – gegen die Vorstellung einer «Rückkehr des Religiösen» im ausgehenden 20. Jahrhundert. Er vertritt die These, dass die Säkularisierung die Religionen zwar nicht ausgelöscht, diese aber verändert habe, indem sie sie aus ihrem kulturellen Kontext herauslöste. Die «Rückkehr des Religiösen» sei nicht mehr als eine «optische Täuschung», hervorgerufen durch eine Säkularisierung, die das Religiöse erst hervorhebe und sichtbar mache, indem sie die Religionen zu einer Neuformulierung in einem «säkularisierten Raum» zwinge. Fundamentalistische Formen von Religion seien so gesehen nicht vor- und auch nicht antimodern, sondern eben gerade besonders moderne Phänomene, da sie ihre eigene Dekulturation akzeptieren und daraus ihren «Anspruch auf Universalität» ableiten würden. Der Weg zum Heil führe bei solchen modernen Religionen nicht über das Wissen, sondern über den Glauben: Roy spricht von einer «sainte ignorance». Das Argument ist universal gedacht. Es bezieht sich nicht auf eine bestimmte Religion oder eine einzelne Region, sondern auf alle religiösen Bewegungen in der modernen Welt. Seine Überlegungen zum Verhältnis von Säkularisierung, Religion und Kultur lassen sich indes auch als Ausgangspunkt für konkrete, problembezogene Fragestellungen anwenden.
Die drei Beispiele zeigen uns erstens, dass wir gut daran tun, Prozesse der religiösen Modernisierung genau zu studieren – auch dort, wo lange Traditionen und Formen vermeintlich zeitloser Religiosität vorliegen. Wir sollten also nicht nur danach fragen, welche modernen Mittel die Kirche einsetzte, sondern auch danach, wie sie alte Traditionen im 19. Jahrhundert umdeutete. 19Mit welchen neuen Funktionen und Attributen wurden beispielsweise die Heiligen ausgestattet? Und blieb die barocke Andachtsliteratur, die ihren Titeln nach bis ins 20. Jahrhundert in Tausenden von Ausgaben und Millionen von Exemplaren verbreitet wurde, die ganze Zeit dieselbe?
Die drei Beispiele zeigen uns zweitens aber auch, dass es sich lohnt, auf das Verhältnis zwischen Religion und Kultur zu achten. Die Epoche zwischen 1830 und 1960 war in der Geschichte des Katholizismus ein historischer Sonderfall. Den Einfluss, den die katholische Kirche bis in die hintersten Winkel des Alltags und des Familienlebens der Katholiken ausübte, gab es weder vorher noch nachher. Franz-Xaver Kaufmann sprach für diese Epoche von einer «Verkirchlichung» 20des Katholizismus, in der die Kirche sakralisiert, hierarchisiert und klerikalisiert und die Katholiken damit einhergehend diszipliniert wurden. Die Disziplinierung funktionierte durch eine tiefe Inkulturation des katholischen Glaubens und seiner Wertvorstellungen. Die Inkulturation vollzog sich in allen Sphären des Lebens: in der Schule, in Vereinen und im Gottesdienst genauso wie bei der Lektüre von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern.
Dem heutigen Betrachter mag das «katholische Milieu» des 19. und 20. Jahrhunderts zunächst als eine Art religiöser Monolith erscheinen. Diese hohe Sichtbarkeit könnte indes, liesse sich in Anlehnung an Olivier Roy sagen, damit zusammenhängen, dass die Säkularisierung weite Bereiche der Gesellschaft tatsächlich erfasste und dadurch die (noch) nicht säkularisierten Bereiche umso deutlicher hervortreten liess. Für die Katholiken aber, die sich innerhalb ihres Milieus bewegten, liessen sich Kultur und Religiosität kaum voneinander trennen. War es ein religiöser Akt, eine Fortsetzungsgeschichte in einer Missionszeitschrift zu lesen? Oder sonntags den Gottesdienst und anschliessend das Wirtshaus zu besuchen? Erfolgte der Eintritt in einen katholischen Turnverein aus religiöser Überzeugung? Dieser «kulturelle Katholizismus» ist, genauso wie aufgeklärt-liberale oder auch fundamentalistische Formen, eine von mehreren möglichen Gestalten, die Religionen in der Moderne annehmen können.
Unternehmensgeschichte als Religionsgeschichte
Diese Arbeit versteht sich nicht als klassische Unternehmensgeschichte. Sie verfolgt keine betriebswirtschaftlichen Ansätze und versucht nicht, Kapitalverwertungsprozesse historisch zu analysieren. Sie nimmt aber mehrfach Ansätze aus der neueren Unternehmensgeschichtsschreibung auf. Diese begann sich seit den frühen 1990er-Jahren gegenüber anderen Disziplinen zu öffnen und bietet mittlerweile zahlreiche methodische und argumentative Anknüpfungspunkte auch für Historiker aus anderen Forschungsfeldern. Im Folgenden sollen einige für diese Arbeit zentrale Argumente aufgenommen und diskutiert werden. Ausgangspunkt sind zwei stark rezipierte Forscher, die sich in der Vergangenheit mit Unternehmensgeschichte und Unternehmenstheorie befasst haben.
Hartmut Berghoff hat im Rahmen einer 1997 veröffentlichten Monografie zum deutschen Harmonikaproduzenten Hohner und in mehreren folgenden Aufsätzen seinen Ansatz der «Unternehmensgeschichte als Gesellschaftsgeschichte» entwickelt. 21Er geht aus von der allgemeinen Gesellschaftsgeschichte Hans-Ulrich Wehlers, die er zu «entnationalisieren» sucht und auf «kleinere soziale Systeme» wie Unternehmen überträgt. Die Multidimensionalität – Wirtschaft, Sozialstruktur, Politik, Kultur – des wehlerschen Ansatzes komme im begrenzten Raum eines Unternehmens besser zum Tragen als im nationalstaatlichen Rahmen, da dieser ein «hohes Mass an Konkretheit» und eine grössere Tiefenschärfe erlaube. Berghoff wendet sich gegen esoterische Formen der Unternehmensgeschichte, die sich auf innere Vorgänge und Organisationsprobleme konzentrieren, und sieht Unternehmen als eine Art offene Systeme. Die Isolierung der Betriebe von der Aussenwelt gelte es aufzubrechen, so Berghoff. Insbesondere die Wechselbeziehungen zwischen der Firma und ihrem lokalen Umfeld müssten stärker berücksichtigt werden. Darüber hinaus soll aber auch den überregionalen Faktoren, die das unternehmerische Handeln von aussen beeinflussen und strukturieren, grössere Beachtung zukommen: etwa kultureller und sozialer Wandel, technologische Entwicklungen oder sich verändernde Moden. Auch da sollen die Unternehmen als Akteure ernst genommen und nach ihren Instrumenten gefragt werden, mit denen sie die Gesellschaft und die Märkte aktiv prägen. Insgesamt, so lassen sich Berghoffs Überlegungen zusammenfassen, sollte die (deutsche) Unternehmensgeschichtsschreibung von ihrer lange Zeit betriebenen Esoterik wegkommen. Ein Unternehmen kann ein Ort sein, an dem, gleichsam wie durch eine Lupe, auch übergeordnete Fragen historischen Wandels beobachtet und untersucht werden können. 22
Zwischen Unternehmen und Umwelt bestehen also fliessende Grenzen. Bereits Ende der 1970er-Jahre führte der Betriebsökonom R. Edward Freeman den Begriff «Stakeholder» ein, um Manager von Firmen dafür zu sensibilisieren, welchen Akteursgruppen – neben Mitarbeitern, Kunden, Aktionären – man besondere Aufmerksamkeit schenken müsse. 23Stakeholder waren für Freeman Gruppen oder Individuen, die in irgendeiner Form ein Interesse an den inneren Vorgängen, am Erfolg oder Misserfolg einer Firma haben. 24Klassische Stakeholder sind nach Freeman beispielsweise Gewerkschaften, Verbände oder die Standortgemeinde. Alle diese Akteure seien für die Entwicklung einer Firma relevant, weshalb es einen Minimalkonsens zwischen ihnen herzustellen gelte. Freeman machte damit auf die Notwendigkeit für eine Firma aufmerksam, ein soziales Gleichgewicht mit ihrer Umwelt herzustellen, und rückte gegenüber den firmeninternen Organisationsstrukturen allgemein soziale Faktoren in den Vordergrund. Der Stakeholder-Ansatz wurde in der ökonomischen Theorie und Praxis breit rezipiert. Einfluss hatte er insbesondere auf die Literatur in den Bereichen der Unternehmensstrategie. Er diente aber auch als theoretische Grundlage für die Behandlung von Fragen über die ethische und soziale Verantwortung von Unternehmen. Insgesamt ist der Stakeholder-Ansatz im Feld der «Koalitionstheorien» anzusiedeln, die ein Unternehmen als eine Koalition verschiedenster Interessengruppen auffassen. Koalitionstheorien fanden in den vergangenen beiden Jahrzehnten vermehrt auch Eingang in die unternehmenshistorische Forschung. 25
Читать дальше