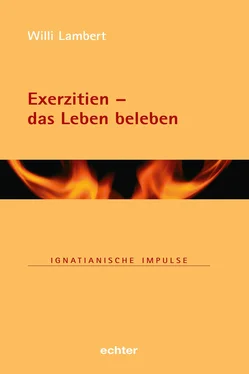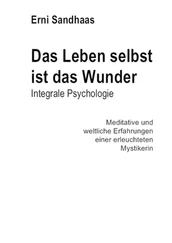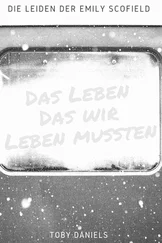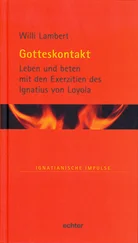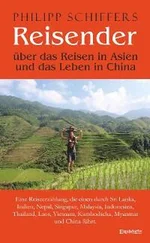Wie ein Buch betitelt ist und beginnt, ist oft schon kennzeichnend für den Autor, für den Inhalt und Stil. Der Titel des spirituellen Bestsellers von Ignatius lautet einfach »Geistliche Übungen« (exercitia spiritualia) und die erste Überschrift des Exerzitienbuches ist gleich ein ganzer Satz: »Anmerkungen, um einige Einsicht in die folgenden Geistlichen Übungen zu erlangen und damit sowohl der, der sie geben, wie der, der sie empfangen soll, Hilfe erlangen (EB 1). In diesem Sinn soll zu Beginn geklärt werden, was »geistlich« meint, was die Rolle des »Übens« und was Ziel und Methode von Exerzitien sind. Dies soll dann weiter entfaltet werden im Blick auf einige der 20 Vorbemerkungen, mit denen das Exerzitienbuch beginnt. Sie erweisen Ignatius als einen Menschen, dem es um Sinnziel und Weghilfe geht. Das Exerzitienbuch habe – so eine fromme Bemerkung – mehr Menschen auf dem Weg zur Heiligkeit geholfen, als es Buchstaben zähle. Ziel und Weg benennt Ignatius in der ersten Vorbemerkung des Exerzitienbuches: Geistliche Übungen, um im Blick auf Gottes Liebeswillen in wachsender Freiheit ein Leben im Lieben zu gestalten (vgl. EB 1). Dabei ist besonders wichtig zu sagen: »Nicht das viele Wissen sättigt und befriedigt die Seele, sondern das Innerlich-die-Dinge-Verspüren und Schmecken« (EB 2).
Besinnung auf das Leben
Ein altes Werbeplakat für Zigaretten zeigt junge Menschen, Strand, Sonne, Meer mit der Aufschrift »That’s life« – »Das ist Leben!« Darunter steht: »Der Gesundheitsminister warnt: Rauchen kann tödlich sein!« Diese Doppelbotschaft legt die Frage nahe: Was ist Leben wirklich und was ist lebensgefährlich? Dies sind wohl Fragen jedes Menschen, dem es ums Leben und ums ganze Leben geht. Es lohnt sich, im Buch des eigenen Lebens zu blättern und sich zu fragen:
– Was kommt mir spontan zur Frage, was Leben für mich bedeutet? Welche Menschen, Worte, Fotos mit Unterschriften, helle und dunkle Stunden lassen mich dies sehen?
– Was wären Kapitelüberschriften für meine Autobiographie?
– Ein Gang auf einem Friedhof kann fragen lassen: Welchen Grabspruch, welche Todesanzeige würde ich wählen und wie sähe mein geistliches Testament aus?
– Was gehört zu Gipfelerlebnissen, was zu den Abgründen meines Lebens?
– Wann war dies und jenes zum ersten oder zum letzten Mal?
– Was waren Anfänge und wann gab’s ein Aufhören?
– Welche inneren Regungen und Haltungen wie etwa Freude, Angst, Ohnmacht, Wut, Hass, Liebe, Freisein kenne ich?
– Wofür möchte ich leben und wofür sterben?
– Was bedeutet für mich »Leben in Fülle«? (Joh 10,10; vgl. 17,3). Für Jesus war es die Liebe und er fragt: Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen?« (Mt 16,25f.).
Begeistert leben: Früchte des Geistes
Die Formulierung »Geistliche Übungen« legt zunächst die Frage nahe, was mit »geistlich« und »Geist« gemeint sein soll. Der Sprachgebrauch gibt Auskünfte: Teamgeist, Klassengeist, Geisterbahn, Begeisterung, Heiliger Geist, böser Ungeist, geistvoll und geistesgestört. Früher nannte man Priester nicht selten »Geistliche« und es wird um »geistliche Berufe« gebetet.
Ich erinnere mich daran, dass meine Mutter gelegentlich mit einem etwas leisen, andachtsvollen Ton in der Stimme sagte: »Die Tante Maria hält sehr viel vom Heiligen Geist.« Es muss mehr gewesen sein als der Rat, man solle bei einer Prüfung zum Heiligen Geist beten. Was hat es mit dem Heiligen Geist auf sich? Gibt es ihn nur auf der Geisterbahn oder mitten in unserem Leben? Die vielleicht einfachste Annäherung an seine Wirklichkeit ist der Verweis auf die bildhafte Sprache der ersten Christen von den »Früchten des Geistes«. Von Früchten lebt man. Eine Reihe davon zählt Paulus auf: »Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung« (Gal 5,22). Sind diese geistlichen Haltungen nicht lebensspendend und nah am alltäglichen Leben? Ob Menschen einander liebevoll oder missachtend begegnen, macht einen Unterschied und ebenso, ob jemand Mitempfinden hat oder alles an ihm wie an einer Plastikhaut abläuft. So ließe es sich vielfach weiterformulieren. Innere Haltungen äußern sich im konkreten Leben als freundlicher Gruß, als Krankenbesuch, als angemessene Rücksichtnahme auf Nähe und Abstand nicht nur in der Zeit der Pandemie, als Hausaufgabenhilfe, Verlässlichkeit und Treue, verständnisvolles Zuhören, finanzielle Unterstützung und all die vielfältigen Weisen des Begegnens.
Die Wirklichkeit des Geistes zeigt sich auch durch die Nennung der Früchte des Ungeistes, in der Bibel oft mit dem Wort vom verderblichen und verwesenden »Fleisch« bezeichnet. Dazu zählt Paulus: »Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid und Missgunst, Trink- und Essgelage und Ähnliches mehr« (vgl. Gal 5,13–26). Der doppelte spirituelle Speisezettel stellt die Frage: Wovon nähren wir uns? Sind es Giftstoffe oder lebensfördernde Seelenspeisen? Paulus schreibt in seiner kräftigen Sprache: »Das ganze Gesetz ist in einem Wort zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander beißt und verschlingt, dann gebt acht, dass ihr euch nicht gegenseitig umbringt« (Gal 5,14f.).
Die geistlichen Übungen von Ignatius sind ein Beitrag zur Nahrung des inneren, des seelischen Menschen. Da geht es in erster Linie nicht um Kilokalorien, vegetarisches, veganes Essen, sondern um die spirituelle Gewichtung: »Das Gewicht der Seele ist die Liebe«, so Ignatius. Exerzitien sind eine Art Diät und Reha-Zeit der Seele und beleben mit der Frage: »Wes Geistes Kind bin ich?« Die vielgenannte »Kirchenkrise« ist wesentlich eine Heilig-Geist-Vergessenheit.
Exerzitien – Leben einüben
Exerzitien, exerzieren stammt vom Lateinischen exercere, was »üben« bedeutet, und dies wiederum kommt aus der Formulierung »ex arce«, d.h. aus der Burg herausgehen. Das Heer übt sich, um im Notfall für den Kampf, den Schutz bereit zu sein. Für Ignatius gehörte das Üben von höfischen Sitten, diplomatischer Sprache und Verhandlungsführung, Verwaltungsaufgaben bis hin zum Training mit Waffen zum täglichen Geschehen; Letzteres liebte er besonders.
Leben lebt vom Üben, vom Einüben und Ausüben. Was gibt es, was ohne Üben geht? Sprechen, Singen, Musizieren, Arbeiten, berufliches Tun, Gesprächsführung, Entscheiden, Training beim Sport, Beziehungskultur, Tugenden, innere Haltungen, Wissenschaft mit ihren Experimenten. Gewohnheiten und alles Lernen sind ganz wesentlich verbunden mit Üben. Übung ist ein wiederholtes Tun auf ein bestimmtes Ziel hin und mit bestimmten Methoden. Das mag streckenweise anstrengend, ermüdend, langweilig und langwierig sein und nur mit Geduld und Lernbereitschaft und mit demütigem Repetieren zum Ziel führen. Es ist, wie Otto Friedrich Bollnow in seinem Buch »Vom Geist des Übens« schreibt: »Vom Kennen zum Können führt nur das Üben.« Und eine wesentliche Botschaft ist der vielsagende Titel des Bestsellers von Erich Fromm: »Die Kunst des Liebens«. Viele Liebesbeziehungen scheitern seiner Erfahrung nach daran, dass Liebe mit Verliebtheit verwechselt wird. Liebe wächst nur im gegenseitigen Lernen und Üben; man könnte auch sagen durch Inspiration und Transpiration.
Üben ist ein Akt der Hoffnung
In diesem Wort kommt zum Ausdruck, dass Üben nicht ein stures, sozusagen absichts- und hirnloses Wiederholen ist, sondern einem Sinn und Zweck dient. Dies wird auch deutlich, wenn man der Wortwurzel von Üben, nämlich »uoben«, nachgeht. Es bedeutet laut Lexikon: pflegen, bebauen, verehren. Die vermutlich aus dem bäuerlichen Bereich stammenden Menschen sahen im Prozess des Wachsens sozusagen drei Dimensionen: Man muss ein Feld bebauen, dann das Ausgesäte pflegen und schließlich müssen sie offensichtlich das ganze Geschehen mit einer Art Ehrfurcht wahrgenommen haben. Dieser Dreiklang bestätigt sich durch das lateinische Wort colere. Beim Lernen musste man sich die Sache einprägen: colere heißt pflegen, bebauen, verehren. Das Geschehen von Kultur und Kult kommt von dorther.
Читать дальше