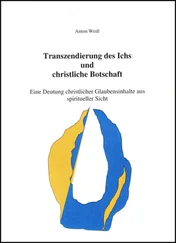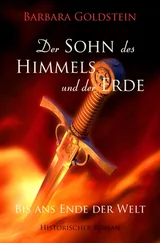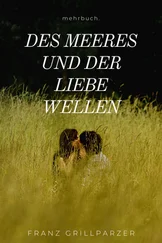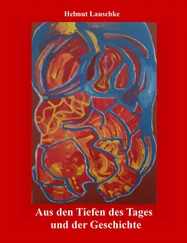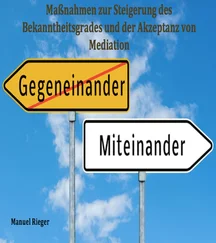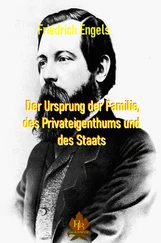18Als erste wissenschaftliche Einrichtung hat sich der Lehrstuhl für Kirchenrecht und Staatskirchenrecht der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Fribourg in Institut für Religionsrecht umbenannt. Heinrich de Wall, Christian Walter und Stefan Korioth haben 2010 eine neue Schriftenreihe zum Religionsrecht etabliert (Nomos). 2014 wurde an der Johannes Gutenberg-Universität das Zentrum für Interdisziplinäre Studien zum Religions- und Religionsverfassungsrecht gegründet.
19Vgl. zum Stand der Diskussion: Axel Frhr. von Campenhausen, Heinrich de Wall, Staatskirchenrecht, München 42006, 38 f.
20Vgl. Ansgar Hense, Kirche und Staat in Deutschland, (Fn. 1), 1836ff.
21Vgl. hierzu Ansgar Hense, Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht (Fn. 14), 9 ff.
Kapitel 1: Normative Grundlagen für das deutsche Religionsrecht – heute nur noch deutsches Recht?
Trotz aller Probleme mit denen die Europäische Union in den zurückliegenden Jahren und auch gegenwärtig zu kämpfen hat, sie berühren das Feld des Religions- und Staatskirchenrechts nicht. Es ist eine Tatsache, dass die politischen Handlungsträger in nahezu allen Rechtbereichen eine Harmonisierung und Rechtsangleichung der Bestimmungen anstreben. Trotz aller bestehender Unterschiede in den Details der Verfassungen der Mitgliedsstaaten wird man jedoch bereits, ohne hier harmonisieren zu müssen, die essentiellen Freiheitsrechte überall als gegeben ansehen dürfen. Freilich sagt das noch nichts über das jeweilige Verhältnis von Staat und Religionsgemeinschaften aus. Auf dieser verfassungsrechtlichen Ebene ist es ohnehin fraglich, ob eine Harmonisierung unbedingt erstrebenswert erscheint, oder ob nicht gerade hier unterschiedliche Konzeptionen im Lichte der jeweiligen historischen Entwicklungen bewahrenswert sind. Das gilt umso mehr, als diese Entwicklungen teilweise auch zur besonderen nationalen Identität des Staatsvolkes gehören. Schließlich bleibt daran festzuhalten, dass die Art. 94 und 95 EG (Art. 100 und 100a EGV), teilweise fortgeschrieben in Art. 73 b des Maastricht-Vertrages, eine Harmonisierung und Rechtsangleichung vor allem für den wirtschaftsrechtlichen Bereich vorgesehen haben. 22Für das Staatskirchenrecht sind heute also nicht mehr nur nationale Gesetze für die Religionsgemeinschaften, Verträge zwischen dem Staat und den Religionsgemeinschaften und die jeweilige nationale höchstrichterliche Rechtsprechung maßgeblich, sondern auch europarechtliche Vorschriften, Vereinbarungen und Judikatur.
1. Nationales Recht
An erster Stelle steht freilich wegen der fortdauernden nationalen Souveränität das nationale Recht, das hier in einem ersten Überblick vorgestellt werden soll. Die normativen Grundlagen des Staatskirchenrechts in Deutschland finden sich im Verfassungsrecht von Bund und Ländern und im einfachen Gesetzesrecht, ebenfalls auf Bundes- und Landesebene, welches die verfassungsrechtlichen Grundbestimmungen näher ausfaltet. Aufgrund der Vielfalt der landesrechtlichen Bestimmungen in den jeweiligen Verfassungen, wird auf deren nähere Darstellung verzichtet. Sie orientieren sich, soweit die Landesverfassungen jünger als das Grundgesetz sind, ohnehin an dessen Maßstab. Soweit sie älter sind enthält das Grundgesetz lediglich in der sog. „Bremer Klausel“ des Art. 141 GG einen Abweichungsvorbehalt, der aber ausschließlich auf Art. 7 GG (Religionsunterricht) bezogen ist.
Das Grundgesetz der Bundesrepublik spricht staatskirchenrechtliche Themen unter drei Rubriken an. Im Abschnitt über die Grundrechtewerden jene religionsrechtlichen Bestimmungen zur Sprache gebracht, die unveränderbar den Grundrechtsbestand der Verfassung ausmachen. Es sind:
Art. 3 Abs. 3 GG: Gleichheitsgrundsatz
Art. 4 GG: Religionsfreiheit
Art. 7 Abs. 2 und 3 GG: konfessioneller Religionsunterricht
Im Teil „ Der Bund und die Länder“ legt die Verfassung grundlegend in Art. 30 GG die religionsrechtliche Kompetenz der Länder im föderalen Verfassungsstaat fest: „Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben ist Sache der Länder, soweit dieses Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zuläßt.“
Das Bundesverfassungsgericht hat diese Zuweisung der Kulturhoheit als „Kernstück der Eigenstaatlichkeit der Länder“ hervorgehoben. 23
Art. 30 GG: Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern („Kulturhoheit der Länder“)
Art. 70 Abs. 1 GG: Ausschließliche Gesetzgebung der Länder
Art. 70 Abs. 2 GG: Abgrenzung der Gesetzgebungszuständigkeit
Art. 73 GG: Ausschließliche Zuständigkeit des Bundes
Art. 74 GG: Konkurrierende Gesetzgebung
Art. 75 GG: Rahmengesetzgebung des Bundes
Zudem ist in diesem Abschnitt der Verfassung gem. Art. 33 Abs. 3 GG das Verbot der religiösen Diskriminierung verankert. 24Sein Kern wird aber grundrechtlich bereits über Art. 3 und 4 GG abgesichert. Art. 33 Abs. 3 S. 2 GG wird als grundrechtsgleiches Recht verstanden, das Schrankenvorbehalten unterliegt. So sind zwar grundsätzlich konfessionsgebundene Staatsämter verboten, dieses Verbot erstreckt sich jedoch nicht auf theologische Hochschullehrende, Religionslehrer und Religionslehrerinnen sowie Geistliche und pastorale Dienste und deren Folgedienste in der Anstaltsseelsorge. 25
Die „ Übergangs- und Schlussbestimmungen“ sind aus religionsrechtlicher Perspektive besonders wichtig, weil hier der Weimarer religionsrechtliche Verfassungskompromiss, soweit das Grundgesetz es nicht selbst regelt, über Art. 140 in das Grundgesetz als Grundgesetzbestandteil inkorporiert wird. Dabei handelt es sich um folgende Normen:
Art. 136 WRV: Konkretisierung der individuellen Religionsfreiheit
Art. 137 WRV: Stellung der Religionsgemeinschaften
Art. 138 WRV: Vermögensfragen
Art. 139 WRV: Sonn- und Feiertage
Art. 141 WRV: Militär- und Anstaltsseelsorge
Art. 141 GG: „Bremer Klausel“
Geht es in dieser ersten Übersicht um eine Bestimmung der unabdingbaren Kernnormen des deutschen Staatskirchenrechts, so ist der Art. 4 über das Grundrecht der Religionsfreiheit und der Art. 137 über die Stellung der Religionsgemeinschaften im säkularen Verfassungsstaat hervorzuheben. Alle übrigen Bestimmungen entfalten in einem engeren oder weiteren Zusammenhang diese beiden verfassungsrechtlichen Grundbestimmungen. 26Die inkorporierten Artikel haben keinen niedrigeren Rang als die übrigen Artikel des Grundgesetzes, sondern sind vollgültiges Verfassungsrecht. Ihre Inkorporation in das Grundgesetz war eine Art „Verlegenheitslösung“, weil man sich auf der Herrenchiemsee-Konferenz nicht auf eine Neuformulierung dieses Rechtskomplexes einigen konnte, sich trotz aller Differenzen jedoch bewusst war, dass es einer Regelung bedurfte. Die in ihrer Substanz bewährten Weimarer Religionsartikel erschienen in diesem Fall als Ausweg aus den stockenden Verhandlungen. Die inkorporierten Artikel standen in der Weimarer Reichsverfassung nicht im Bereich von Grundrechten, sondern im Abschnitt über die „Religion und Religionsgesellschaften“. Es handelt sich um die Art. 135-141; zwei Artikel dieses Abschnitts wurden 1949 nicht in das Grundgesetz inkorporiert. Art. 135 WRV hatte die Religionsfreiheit behandelt. Seine Inkorporation war wegen Art. 4 GG obsolet. Art. 140 WRV hatte gelautet: „Den Angehörigen der Wehrmacht ist die nötige freie Zeit zur Erfüllung ihrer religiösen Pflichten zu gewähren .“ Diese Bestimmung wurde für überflüssig angesehen, weil man 1949 nicht damit rechnete, dass es in dem neuen Staat nach der Ordnung des Grundgesetzes je wieder ein Militär geben würde. Außerdem war die Seelsorge in der Armee für den Fall der Wiederbewaffnung über das Reichskonkordat hinreichend abgesichert.
Der Unterschied zwischen den Grundrechten und dem übrigen Verfassungsrecht liegt vor allem auf der Ebene der Möglichkeit der juristischen Einklagbarkeit verletzter Rechte. Im Falle der Verletzung von Grundrechten (Art. 1-19 GG), besteht für jeden betroffenen Bürger und in einigen Fällen auch für jeden Betroffenen unabhängig von der deutschen Staatsbürgerschaft, die Möglichkeit einer Verfassungsbeschwerde (Art. 93 Abs. 4a GG). Das Gleiche gilt für die sog. grundrechtsgleichen Rechte, wie z.B. Art. 33 Abs. 3 S. 2 GG. Wir unterscheiden in diesem Feld die sog. Jedermannsrechteund die Bürgerrechte. Jedermannsrechte lassen sich durch Klauseln wie: „Jedermann, jeder, alle Menschen, oder niemand“ kennzeichnen. Dazu werden auch Freiheitsrechte gerechnet, die ohne personale Einschränkung gewährt oder gewährleistet werden. 27Bürgerrechte und Bürgerpflichten, die in der verfassungsrechtlichen Literatur auch als „Deutschenrechte“ bezeichnet werden, stehen folglich nur jenen zu, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Dabei handelt es sich weitgehend um bürgerliche Partizipationsrechte und – pflichten. 28
Читать дальше