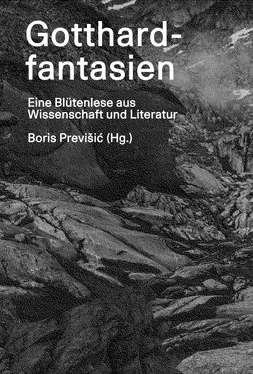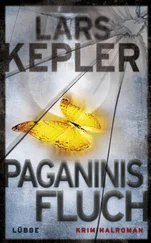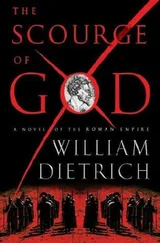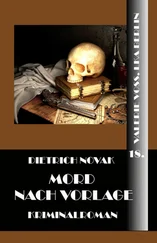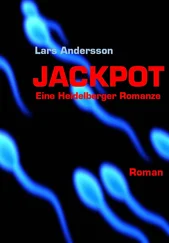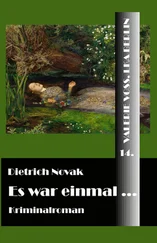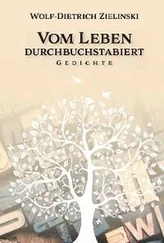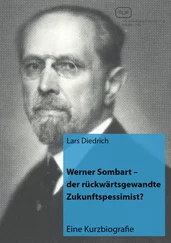Alexander Honold
Warum der Gotthard so wichtig ist. Der Einklang von Ursprung und Fortschritt als nationaler Traum
Peter von Matt
Heidelbeeren und der heilige Antonius
Verena Stössinger
Bahntechnik Gotthard-Basistunnel. Vision und Verwirklichung eines Grossprojekts
Lars Dietrich
Die Polyfräse
Peter Weber
KONTRAPUNKTE
Der Gotthard im russischen kulturellen Gedächtnis. Die Alpenüberquerung Suvorovs (1799) als Erinnerungsort
Frithjof Benjamin Schenk
Hannibals Manöver in den Wolgasteppen. Brodsky tunnelt Suvorov
Jens Herlth
denkmal / im sandkasten
Katharina Lanfranconi
Ein Gotthard auf dem Balkan? Wie sich die Schweiz von der südslawischen Romantik inspirieren lassen kann
Anna Hodel
Sasoun. Mythos eines armenischen Bergréduits
Elke Hartmann
Über den Gotthard
Arno Camenisch
Vom «Felsenthron Europas» zum neuen Kanton Tessin. Gotthard-Reisen von 1770 bis 1800
Thomas Fries
«Kennst du das Land?» Goethes transalpine Rätsel
Daniel Müller Nielaba
Auf der Gotthardstrasse. Vom Dach Europas zum Zentrum der Erde
Luigi Lorenzetti
Brüllt der Stier oder der Ochs?
Iso Camartin
BILANZEN, SZENARIEN
Der Schatten des Passheiligen, das letzte Wort des heiligen Gotthard und was daraus wurde. Eine historische Miniatur
Pirmin Meier
Der San Gottardo, Leid und Freude des Tessins. Ein Transitweg zwischen Hoffnungen und Enttäuschungen
Marco Marcacci
Das Wunder von Ambrì. Ein Dorf, ein Hockey-Team und ihr unvermuteter Beitrag zur Integration von Inländern
Nenad Stojanović
Die Gotthard-Region – schwarzes Loch oder globaler Exportschlager? Zur divergierenden Wahrnehmung der Berge in der Schweiz nach 1970
Jon Mathieu
hoher berg
Katharina Lanfranconi
Wege zum Gotthard-Mythos
Guy P. Marchal
Gotthard-Mythen und Geschichtspolitik. Kontinuitäten und Gegennarrative
Damir Skenderovic
Berg unter, oder wie der Gotthard auf die Malediven kam. Ein Prozess
Walter Leimgruber
Fragmente aus Gotthard Super Express
Matteo Terzaghi
Klaus Schädelin, Yoko Tawada, Hermann Burger. Literarische Gegenkonstruktionen am Gotthard
Boris Previšić
Autorenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Warum Gotthardfantasien?
Eine Einführung
Boris Previšić
2015 wurde die Geschwindigkeit der Versuchszüge im Gotthard-Basistunnel Stufe um Stufe erhöht. Die konstante Beschleunigung im Tunnelinnern konkretisiert den abstrakteren Vorgang der Modernisierung, der Automatisierung, der Vernetzung, des unbeschränkten Waren- und Personenverkehrs in einem Ausmass, wie es die Menschheit von Beginn der Industrialisierung bis in unsere Tage noch nie gekannt hat. Der Gotthard-Basistunnel ist zugleich Motor wie Symptom unserer Zeit. Er bricht mit seinen 153,3 Kilometern ausgebrochenen Tunnels unzählige Rekorde. 1Der Alpenbogen, das grösste geologische, topografische und meteorologische Hindernis, das Wasserschloss, aber auch die Kulturgrenze zwischen Norden und Süden Europas, wird erstmals ohne Höhenüberwindung technisch untergangen. Dennoch stehen wir vor einem Dilemma: Es hat sich noch nicht eine «Geschichte im Sinn eines etablierten Narrativs und eines in unseren Köpfen lebenden Geschichtsbildes» entwickelt. 2Wie kann das Abstrakte, vielleicht auch das unheimlich Unfassbare dieses Riesenbauwerks, dessen Ausbruchmaterial einen Güterzug von der Strecke von Luzern nach New York füllt, überhaupt erzählt werden? Gerade heute sind wir dazu angehalten, Sinnangebote zu konstruieren und anzubieten. Die Erzählung muss für ihre Sinnhaftigkeit perspektiviert werden – im Unterschied zum Mythos, der wie schon der Sirenengesang dem Odysseus uns vielleicht am verlockendsten erscheint.
Der Mythos bringt die kohärenteste Erzählung hervor. Spricht man von Mythos, geht es nicht um die umgangssprachliche Unterscheidung zwischen falscher und richtiger Geschichte, sondern um eine mythentheoretische Einordnung des Gotthards. Weil Mythostheorien auf viele verschiedene Gegenstandsbereiche der Ethnologie, der Altertumswissenschaften, der Gegenwarts- oder der Alltagsgeschichte abzielen, fallen sie entsprechend unterschiedlich aus. 3Folgt man der Unterscheidung von Mythos und Geschichte durch den Ethnologen Claude Lévi-Strauss, so ist die Geschichtsschreibung als offenes System zu verstehen, welches die Differenz zwischen Gegenwart und Zukunft darlegt. Die Mythologie hingegen funktioniert statisch als geschlossenes System. Ihr geht es um Kohärenzbildung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 4Lévi-Strauss spricht in diesem Fall von narrativer Bricolage zwischen Geschichte und Mythologie, Guy P. Marchal von «Gebrauchsgeschichte». Roland Barthes unterstreicht, dass der Mythos Geschichte in Natur umformt, naturalisiert (in der französischen Doppeldeutigkeit von Naturalisierung und Nationalisierung) und somit im alltagskulturellen Kontext nicht mehr hinterfragbar macht. 5
Die Anfänge einer Gotthardmythos-Genealogie sind in der Aufklärung anzusetzen – zu einem Zeitpunkt, als Mitglieder der «ersten gesamtschweizerischen Vereinigung, der Helvetischen Gesellschaft» auf der Basis einer Tugendphilosophie nach Rousseau den homo alpinus als den guten Wilden schufen. Dabei stützte man sich auf ausgewählte Literatur über die Alpen, die angesichts eines einsetzenden deistisch grundierten Erhabenheitsdiskurses ins Blickfeld der Aufklärer gelangten. Dazu sind in erster Linie Johann Jakob Scheuchzer (1672–1733), Albrecht von Haller (1708–1777) und Johann Caspar Lavater (1741–1801) zu zählen. 6So fanden erst im 18. Jahrhundert die Alpen richtig Eingang ins Imaginationsarsenal der Alten Eidgenossen. Der richtige Schweizer sei nur in den Alpen zu finden. Und so hat das «Schweizeralpenland» «bis heute seine Decodierbarkeit und damit seine Wirkung behalten». Nirgends kam es «zu einer dermassen wirksamen Kombination von Geschichte und Alpen […] wie in der Schweiz». 7Umso erstaunlicher ist es, wie spät das breitenwirksame Nation Building, die «Narration of Nation», 8einsetzt und sich in entsprechenden Denkmälern niederschlägt. Erst 1859 und somit zwölf Jahre nach dem Sonderbundkrieg kam das Rütli als Symbol des neu entstandenen Bundesstaates in den Besitz der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft; erst 1879/80 wurde die Tellskappelle, wie wir sie heute kennen, errichtet. Die Verbreitung von nationalen Standards konnte erst mit einer gewissen zeitlichen Distanz zu den innerhelvetischen Zerwürfnissen einsetzen und fiel just in jene Jahre, in denen man den Gotthard-Scheiteltunnel plante, ausbrach und in Betrieb nahm. Dass der Gotthard in einem breiteren öffentlichen Bewusstsein überhöht werden konnte, war der Koinzidenz von nationaler Symbolpolitik und technischer Errungenschaft geschuldet. Der Gotthard als Kultur- und Wasserscheide, als Ursprung von vier wichtigen Flüssen; der Gotthard als Zentrum der Schweiz, der Gotthard als Zentrum der europäischen Kulturen.
Dem Gotthard kommt exemplarische Bedeutung zu, da Staatsgründungs- und Technikerzählungen miteinander verschränkt werden. Die Kohärenz des Gotthard-Mythos kulminiert in der Geistigen Landesverteidigung, in welcher ländliche Ursprünglichkeit und technischer Fortschritt eine einzigartige Symbiose bilden. 9Zwar formuliert Ernst Cassirer seinen Mythus des Staats (1949) im Hinblick auf das Aufkommen des totalitären modernen «Mythus» im nationalsozialistischen Deutschland. Dennoch gilt die «Technik der modernen politischen Mythen» 10auf eigenartige Weise auch für die Schweiz in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg. So erreiche der Mythus «seine volle Kraft, wenn der Mensch einer ungewöhnlichen und gefährlichen Situation begegnen muß». 11Selbst in indigenen Gesellschaftsformen werden Mythen nur punktuell und gezielt eingesetzt, wo «ein Geschäft» «gefährlich und sein Ausgang ungewiß ist». 12Die subjektiv empfundene Bedrohungslage in der Schweiz, eingeklemmt zwischen dem totalitären Deutschland und Italien, ist nicht zu unterschätzen – vielleicht weniger in strategisch-militärischer als in ideologischer Hinsicht. Auch die Schweiz war anfällig für antidemokratische Ideen. Während aber der nationalsozialistische «Mythus der Rassen» in Deutschland im Alltag Fuss fassen konnte, musste die Schweiz auf ein anderes ideologisches Versatzstück zurückgreifen.
Читать дальше