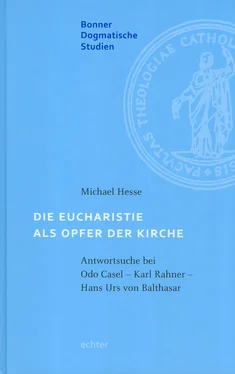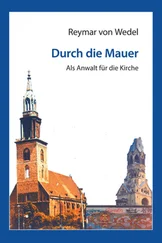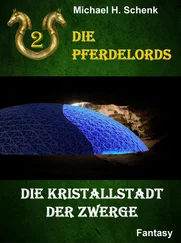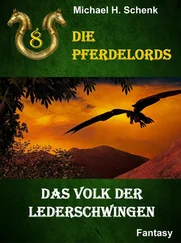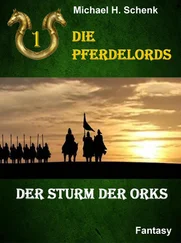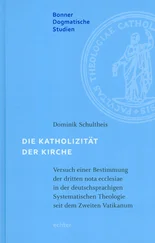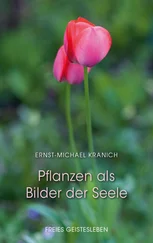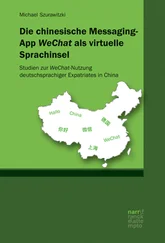2.3 Der Schlüssel der Mysterientheologie: Der Glaube
Der Glaube des Christen ist in der Denkform Casels der Schlüssel zu Christus selbst. Glaube unterwirft sich dabei die Ratio. Die Erkenntnis, dass das Christentum durch die Offenbarung Gottes ausgezeichnet ist, lässt ihn zur Schlussfolgerung gelangen, dass hier eine „Gottestat“, eine Handlung aus der Ewigkeit in der Zeit, existiert, deren Ziel aber in der Ewigkeit Gottes liegt. Das Christentum wird demnach als eine Gottestat verstanden, weil das Christentum als Offenbarung bzw. Handlung Gottes ausgewiesen ist. Schilson zeigt, dass Casel im Christentum zusätzlich zur Gottestat eine zweite άρχή (ein zweiter Urgrund) existieren sieht, nämlich in Christus selbst, was wiederum das Christentum vom antiken Mythos abgegrenzt, da nach Casels Ansicht eine einzige Urhandlung keine Identität stiften oder aufrechterhalten kann. So schließt sich logischerweise die Forderung an, nach einer möglichst intensiven Gemeinschaft mit dem zweiten Urgrund Christus zu suchen. Somit ist deutlich, dass diese Denkform das Christentum seinem Wesen nach als Christomonismus sieht. 349Der Glaube des Menschen eröffnet das Mysterium. Damit beginnt jedoch eine neue Anforderung an den Gläubigen: Nachfolge.
2.4 Die Nachfolge Christi als Mysteriennachfolge
Blicken wir auf eine Dimension des Christseins, nämlich auf die Möglichkeit zur innersten Teilhabe am Tun Jesu Christi. Diese innerste Teilhabe macht laut Casel den Menschen nicht zu einem Nachahmer, sondern zu einem wahren Mysten, einem Eingeweihten, der das Leben Christi mitlebt und mittut. Darin besteht die Mysteriennachfolge, wie sie Casel verstanden wissen will. 350Der Weg des Christen wird in der Weise gezeichnet, dass er durch das Kreuz hindurch gehen muss, um den alten, irdischen Mensch abzulegen. Der Mensch muss durch das Gleichbild des Todes Christi in der Taufe und im täglichen Kreuztragen ein neuer Mensch werden. Nur so kann der Mensch dem zum Vater erhöhten Herrn gleich werden. So erfolgt auch die Fähigkeit, das Pneuma Christi aufzunehmen, um so Christus zu erkennen. Die Erkenntnis Christi gestaltet den Menschen dem Herrn gleich. So werden die, die Christus erkannt haben, teilhabend an der Herrlichkeit Christi, zu Töchtern und Söhne Gottes. Die Grundlage dieses Prozesses ist letztlich das Pneuma, die Ostergabe Christi, die Gabe der göttlichen Agape. Casel weist gleichzeitig darauf hin, dass das Pneuma zugleich göttliche Person ist. So kommt dem Pneuma zweifache Dimension zu. Es ist Gabe, als österliche Gabe durch Tod und Auferstehung Christi, und zugleich auch Geber, als göttliche Person der Dreieinigkeit. Das bedeutet für die Gläubigen, dass sie wahrhaft bei Gott sind, weil das mitgeteilte Pneuma den Eintritt in die Ewigkeit Gottes ermöglicht, auch wenn der Mensch immer Geschöpf bleibt und Gott unterstellt ist in der Agape, die Gott wiederum selbst ist. 351Die Rolle des nachösterlichen Pneumas Christi müssen wir an dieser Stelle im Bezug auf das Verhältnis des Menschen zum Christusmysterium genauer betrachten, ohne hier schon in die dezidierte Ekklesiologie Casels vordringen zu wollen. Sie werden wir erst im folgenden, dritten Paragraphen behandeln. Zunächst aber soll es im Folgenden um das individuelle Verhältnis des gläubigen Menschen zu Christus gehen.
2.5 Christusmysterium – Christusmystik – Christologie in Liturgie – Christusgnosis
Beginnen wir nochmals beim Zentralbegriff der Caselschen Theologie schlechthin, dem Mysterium. Casel sieht im urchristlichen Begriff „Mysterium“ eine Lebenswirklichkeit ausgesagt, die den ganzen Menschen angeht und deren zentralste Verwirklichung sich schließlich im Kult zeigt. Die Christuserkenntnis soll nicht auf der Ebene des Rationalismus gesucht werden, wie es Casel den Neuscholastikern vorwirft, sondern mittels praktischer, d.h. kultischer Erfahrung, erfahren werden. Der Kultteilnehmer erlebt dort das Einverleibtwerden in göttliche Wahrheitssubstanz, ja das Hineingezogenwerden in Christus und so in Gott selbst. Casels Position der Gotteserkenntnis hat somit eine dreifache Ausfaltung. Zunächst ist Christus durch den Glauben anzuerkennen. Dann muss die im Glaubensgehorsam erlangte Wahrheit mittels Gebet und Studium der Schriften vertieft werden. Letztlich ergibt dieses ein lebendiges Hineinwachsen in eine immer inniger werdende Christusvereinigung bei gleichzeitiger wachsender Gnosis, Gnosis im oben schon dargelegten spezifischen Sinne Casels. Casels Weg lässt sich als ursprünglicher Weg einer Christus-Mystik charakterisieren, die wesentlich praktische Erkenntnis und Wissenschaft beinhaltet. Voraussetzung ist immer die Teilnahme am Kultmysterium. Diese Christus-Mystik ist nicht ein subjektives Vollziehen einer Mystik, sondern die Kirche bildet den Ort objektiver Mystik. Damit wird eine Trennung zu neuzeitlichen Mystikformen gezogen, die nach der Beziehung der Seele zu Gott fragen. Die Praxis des Glaubens und die Praxis des sakramentalen Lebens bilden den Rahmen der Caselschen Christus-Mystik, d.h. eine Art Christus-Vereinigung. 352Diesen Baustein in Casels Ansatz werden wir später in der Betrachtung der Ekklesiologie vertiefen. Hier zunächst nur die Feststellung: Das Sakrament ist der Ort, an dem diese wahre Begegnung und Angleichung an die sakramental repräsentierte Heilstat Christi vollzogen wird. Der Mensch wird als ganzer angesprochen und pneumatisch umgeprägt. 353Die Heilstat Christi, die hier genannt wird, verweist zugleich auf eine weitere Verknüpfung mit der Christologie hin. Casels Christozentrik ist soteriologischanthropologisch ausgerichtet. 354
Bei Casel steht immer die Christus gewirkte Erlösung im Zentrum seiner Überlegungen. Daher ist eine genetische Herleitung des christlichen Mysteriums aus den heidnischen unmöglich. Die Analogie ist gleichfalls ausgeschlossen, jedoch nicht eine Abhängigkeit. 355Daraus ergibt sich das Caselsche Verständnis des Christentums, das nicht eine Weltanschauung mit religiösem Hintergrund sein soll. Ebenso soll es mehr sein als ein System von dogmatisch festgelegten Wahrheiten. Auch soll es nicht allein von der Religiosität eines Individuums her geprägte Haltung Gott gegenüber sein. Bei Casel zeigt sich das Christentum als Religion der Christus-Mystik, der Einswerdung mit dem pneumatischen Herrn, Einswerdung mit Christus im Pneuma. Das Leben eines Christen wird dem Leben Christi gleich. Darin zeigt sich ein objektives Lebensprinzip, dass mehr sein soll als das Nachleben des Lebens einer anderen geschichtlichen Person, hier dem Leben Christi (Casels Distanz zur Leben-Jesu-Frömmigkeit und der Ablehnung der liberalen Theologie wird darin deutlich). Was Casel will, ist personale Christusmystik, eine Verbundenheit mit Christus, die das ganze Dasein des Menschen ergreift, was dennoch keinesfalls in individualistische und innerliche Mystik abgleiten soll. Im Christentum geht es demnach um die Gottesbeziehung von Gott und Mensch, die in Christus offenbar geworden ist. 356Es zeigt sich eine Verschränkung von Theozentrik, Christozentrik und Anthropozentrik. Der Sinn des Christentums liegt in Casels Theologie darin, dass der Mensch zum „Christus“ umgestaltet wird. D.h., dass es zu einer Umformung zur Urform, zu einem zweiten Christus kommen soll. Der Mensch ist Abbild Gottes und somit auch als Mysterium bezeichenbar. Es geht Casel um den „wahren Menschen“. Der Christ ist Christus, der neuen άϱχή, nachgebildet. Das Menschsein wird so ganz über die Christozentrik definiert. 357
3. Zusammenfassung und Ausblick
Die Menschheit Jesu selbst hat jedoch bei Casel keine hohe Wertschätzung. Es liegt eine „Christologie von oben“ vor, die in Analogie zur Anthropologie zu sehen ist. Der irdische Jesus ist nur da von Interesse, wo es um die Heilstaten geht, die im Credo genannt werden. Das Leben und die Gestalt Jesu erhalten erst von Tod und Auferstehung her ihre Bedeutung. Inspirationsgeber ist dazu der Philipperhymnus, den Casel als eine „Verklärungschristologie“ versteht. Das Problem dieser Konzeption liegt wiederum in der Ausblendung der kontingent-geschichtlichen Ereignisse überhaupt. Der geschichtliche Christus tritt immer mehr in den Hintergrund zu Gunsten des mystischen Christus. Dies tritt in Konkurrenz zum Verständnis biblischer Heilsgeschichte. 358
Читать дальше