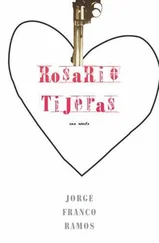1 ...8 9 10 12 13 14 ...34 Was genauer sind die Ziele? Es geht um eine lernende Versorgung:
Das Ziel der Versorgungsforschung ist, die Kranken- und Gesundheitsversorgung als ein System zu entwickeln, das durch das Leitbild der „lernenden Versorgung“ gekennzeichnet ist und das dazu beiträgt, Optimierungsprozesse zu fördern und Risiken zu vermindern. Dabei ist die Versorgungsforschung den Zielen Humanität, Qualität, Patienten- und Mitarbeiterorientierung sowie Wirtschaftlichkeit gleichermaßen verpflichtet. (Arbeitskreis „Versorgungsforschung“ beim Wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer 2004)
Um das mögliche Optimum an Versorgungsqualität zu erreichen, brauche es „ergebnisoffene Versorgungsforschung mit relevanter Fragestellung und valider Methodik. Wir erkennen zunehmend, dass Versorgung multiprofessionell analysiert werden muss, wenn die ganze Komplexität und Kontextabhängigkeit der Interaktion von Arzt und Kranken aufgedeckt und für Verbesserungen zugänglich werden sollen.“ (Scriba 2011, S. V)
Versorgungsforschung ist also keine eigene Wissenschaft, sondern ein Forschungsfeld, das sich methodisch mehrerer wissenschaftlicher Disziplinen bedient (vgl. Schrappe u. Pfaff 2011, S. 381). Vorrangig zu nennen seien hier „die Epidemiologie, insbesondere die Klinische Epidemiologie (Evidenz-basierte Medizin), Organisationswissenschaften/Soziologie, Didaktik, Lernpsychologie und Kommunikationsforschung, Gesundheitsökonomie, Public Health, Rechtswissenschaften, Ethik, Qualitäts- und Patientensicherheitsforschung, Lebensqualitätsforschung, Pflegeforschung und natürlich die Klinischen Fachgebiete“ mit ihren jeweiligen methodischen Herangehensweisen (ebd., S. 383 f.). 48Nur „durch die Beteiligung aller Fachdisziplinen (Multidisziplinarität)“ und „die Beteiligung aller in der Versorgung tätigen Berufsgruppen (Multiprofessionalität)“ könnten die vielfältigen Einflussfaktoren umfassend untersucht und verbessert werden (vgl. Pfaff u. Schrappe 2011, S. 5). Bedenkenswert ist dabei, dass das Ergebnis der Versorgungsleistung eine „Resultante der Gesundheitsleistung und der Kontextleistung“ sei, d. h. aus spezifischen und sogenannten unspezifischen Wirkfaktoren:
Unter Gesundheitsleistung versteht man den spezifischen Wirkbestandteil, wie z. B. die OP-Methode oder das Medikament. Die Kontextleistung umschreibt den Beitrag der „weiteren Umstände“, also der beteiligten Personen (Ärzte und Pflegende), der Institutionen (z. B. Krankenhaus), des Finanzierungssystems. Jeder Arzt kennt die Bedeutung dieser unspezifischen Faktoren, häufig wird hier der Begriff des „Placebo-Effekts“ verwendet. (Schrappe u. Pfaff 2011, S. 382) 49
Versorgungsforschung versuche deshalb auch zu analysieren, welcher Art „die relevanten Kontextfaktoren sind.“ (ebd.)
Viele Autoren unterstreichen, dass solche empirische Forschung unabhängig sein müsse, also nicht auftrags- und interessengebunden sein dürfe (vgl. z. B. Rabe-Menssen et al. 2011, S. 403). „Wenn man Versorgungsforschung nicht im engen Interesse der eigenen politischen, Wirtschafts- oder Berufsgruppe betreibt und fördert, dann erhofft man sich von ihr verlässliche Orientierung – durch neutrale, sachliche und wissenschaftlich belastbare Beschreibungen, Bewertungen, Analysen, Prognosen und Ratschläge.“ (Raspe 2011, S. IX) Allerdings sei sie als angewandte Forschung im Konflikt, dass sie bei Forschungsprojekten mit der Versorgungspraxis und möglichen Interessengruppen eng zusammenarbeiten müsse (vgl. Grenz-Farenholtz et al. 2012, S. 610). Das vom DNVF herausgegebene Memorandum III: Methoden für die Versorgungsforschung (Teil 1) rät deshalb: „In der Regel verfolgen alle Studien bestimmte Interessen. In jeder Untersuchung sind Interessenskonflikte von allen Beteiligten vollständig zu offenbaren und transparent zu dokumentieren.“ (Pfaff et al. 2009, S. 507) 50
Ein zentrales Grundkonzept der Versorgungsforschung ist (neben Ergebnisorientierung, Multidisziplinarität und Multiprofessionalität) die Patientenorientierung (vgl. Pfaff u. Schrappe 2011, S. 2). 51„Bereits im Jahr 1988 hatte Ellwood in der »Shattuck Lecture« darauf hingewiesen, dass es nicht ausreicht, sich der Patientenorientierung des ärztlichen oder pflegerischen Tuns gegenseitig zu vergewissern, sondern dass konkret in Erfahrung zu bringen ist, welche Interessen der Patient hat und wie er in die Entscheidungen einzubeziehen ist“ (ebd., S. 6). Das hat Bedeutung auch für den Bereich Psychiatrie und Psychotherapie: Patienten haben etwas zu sagen – sowohl was ihre Person wie auch ihre Erfahrungen betrifft (vgl. oben S. 10) H. Schott und R. Tölle). Reinhold Kilian und Thomas Becker beobachten bei psychiatrischen Versorgungsleistungen entsprechend dem Empowerment-Konzept (vgl. Abschn. 3.2.5) eine zunehmende Berücksichtigung der subjektiven Perspektive der Betroffenen bei der Erfassung des Bedarfs und der Beurteilung der Qualität gesundheitlicher Leistungen, sowie das Streben nach einer primär an den Ressourcen der Patienten orientierten Behandlung (vgl. Kilian u. Becker 2006, S. 332). Die Evaluation von Versorgung müsse sich auch daran messen lassen:
Der Grad, in dem Gesundheitsleistungen an den vorhandenen individuellen Fähigkeiten und Ressourcen ihrer Nutzer zu einer selbständigen Lebensweise orientiert sind und in dem sie die Erweiterung dieser Fähigkeiten und Ressourcen anstreben und erreichen, bildet nach der Empowerment-Perspektive ein zentrales Kriterium der Qualitäts- und Effektivitätsbeurteilung (ebd., S. 334).
Die vorliegende Studie möchte deshalb zu erhellen versuchen, inwieweit für psychiatrische Patienten ihre Religiosität bzw. Spiritualität persönliche Ressourcen darstellen.
Welche Themen sind in Zukunft für die Versorgungsforschung besonders wichtig? Bei einem Workshop im November 2010 sprachen 36 namhafte Experten (aus den Gruppen Ärzteschaft, Förderer, Wissenschaft und Kostenträger) in vier Fokusgruppen über die Top-Zukunftsthemen (vgl. Grenz-Farenholtz et al. 2012, S. 605). Zu den Top-5-Themen gezählt wurden in der Gruppe der Ärzteschaft unter anderem „Versorgung von chronisch Kranken, Multimorbidität, Versorgung psychisch Kranker“, in einer Fokusgruppe Wissenschaft u. a. „Patienten- und Nutzerperspektive“, in der Fokusgruppe Kostenträger u. a. „Patientenpräferenz Aktivierung/Autonomie“ (vgl. ebd., S. 607 f.). Auch im Plenum wurde hinsichtlich der Indikationen die Versorgung von chronisch Kranken, psychisch Kranken und multimorbiden Patienten als künftig besondere Herausforderung gesehen, dem Themenbereich „Patientenpräferenz“ räumten die Experten insgesamt große Bedeutung ein (vgl. ebd., S. 609). Es scheint, dass die vorliegende Studie sich gut in diesen Rahmen einfügt.
Die Bedeutsamkeit psychischer Störungen wird auch in aktuellen großen Studien zur Epidemiologie eindrucksvoll erkennbar. Im Rahmen einer nationalen Gesundheitsberichterstattung wurde der Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS; Robert Koch-Institut) bereits während der ersten Erhebungswelle der Hauptuntersuchung (DEGS1) ein Modul Psychische Gesundheit (DEGS1-MH) zur Seite gestellt (vgl. Jacobi et al. 2014, S. 77). Diesem „liegt eine bevölkerungsrepräsentative Erwachsenenstichprobe (18–79 Jahre, n = 5317) zugrunde, die überwiegend persönlich mit ausführlichen klinischen Interviews (Composite International Diagnostic Interview; CIDI) untersucht wurde.“ (ebd., S. 79) Die 12-Monats-Prävalenz psychischer Störungen – d. h. das Auftreten von klinisch relevanten, krankheitswertigen Störungen in der Bevölkerung innerhalb eines Jahres – beträgt insgesamt 27,7% (vgl. ebd.). Die größten Störungsgruppen sind Angststörungen (15,3%), unipolare Depressionen (7,7%) und Störungen durch Alkohol- oder Medikamentenkonsum (5,7%) (vgl. ebd., S. 81). 52Diese Ergebnisse liegen im Bereich international vergleichbarer Studien, z. B. im ECNP/EBC Report 2011 (Wittchen et al. 2011): Die 12-Monats-Prävalenz in dieser EU-Studie (bzw. EU-27 plus Schweiz, Norwegen und Island) ist trotz anderer Methodik 53bei Beschränkung auf die in der DEGS1-MH einbezogenen Diagnosen mit 27% nahezu identisch (vgl. Jacobi et al. 2014, S. 83). Die Höhe der Prävalenz mag nicht nur Laien, sondern auch Fachleute erstaunen. Die Diagnosen beruhten aber auf voll erfüllten klinischen Kriterien (zumeist gemäß DSM-IIIR und DSM-IV), auch bezüglich Dauer und Schweregrad (vgl. Wittchen et al. 2011, S. 670). Die große Mehrheit erfahre keine Behandlung (vgl. ebd., S. 671). Das ist auch in Deutschland so: Nur ein geringer Teil dieser Betroffenen „berichtet, im letzten Jahr aufgrund psychischer Probleme in Kontakt mit dem Gesundheitssystem gestanden zu haben (11% derjenigen mit nur einer Diagnose, bis zu 40% der Betroffenen mit mindestens vier Diagnosen).“ (Jacobi et al. 2014, S. 84) Nach Wittchen et al. erfordert diese Datenlage dringend, die geltenden Versorgungsstandards im Bereich mentaler Gesundheit neu zu durchdenken (vgl. Wittchen et al. 2011, S. 670).
Читать дальше