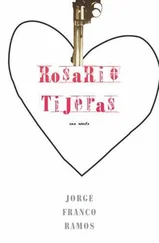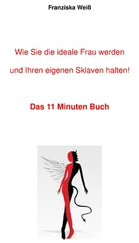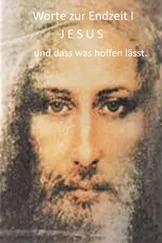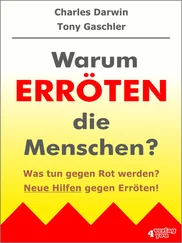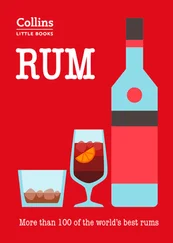1 ...7 8 9 11 12 13 ...34 Klaus Kießling unterstreicht für das interdisziplinäre Gespräch den Bedarf sowohl des Eigenstands der beteiligten Disziplinen als auch von Kriterien für ihren Austausch (vgl. Kießling 2005, S. 124). Im Blick darauf benennt er grundlegende theologische Prinzipien: Schöpfungstheologisch kann „die Autonomie empirischer Erkenntnisse“ gewürdigt werden (vgl. ebd.). 40Die „Zuordnung von ‚profanen‘ Wissenschaften und Theologie“ lasse sich analog zu den christologischen Prinzipien des Konzils von Chalcedon ( unvermischt und ungetrennt) beschreiben – also weder „monophysitische“ Vermischung noch „nestorianische“ Aufspaltung ohne Interdisziplinarität (vgl. ebd., S. 125). In einem pneumatologischen Zugang schließlich könne man ausgehen „von einem Geist, der menschliche Erkenntnisse sowohl als solche anzunehmen als auch zu radikalisieren vermag auf ihr letztes Ziel und ihre Vollendung hin.“ (ebd.) In diesem Kontext ist für unsere theologischen Teile Max Secklers Hinweis bedeutsam, dass die Gottesfrage das umfassende und grundlegende Formalprinzip der Theologie sei – unter Verweis auf Thomas von Aquin, der betone, „daß in der Theologie alle Themen in Ansehung Gottes (sub ratione Dei) zu behandeln sind, sei es, daß diese Themen Gott selbst direkt betreffen, sei es, daß sie eine Beziehung zu Gott als der alles bestimmenden Macht aufweisen.“ (Seckler 1988, S. 181) 41
Für interdisziplinäre Gesprächsfähigkeit wichtig ist der sogenannte methodische Atheismus, den Hans-Günter Heimbrock so beschreibt: Er zielt „nicht auf eine generelle Verneinung des Gottesglaubens, sondern nur auf die Suspendierung spezieller religiöser Voraussetzungen auf Seiten des Forschers für die wissenschaftliche Wirklichkeitserkenntnis. Mit dem Prinzip soll Wissenschaft gegen unüberprüfbar autoritäre Setzungen und irrationale Meinungen gesichert werden.“ (Heimbrock 2007, S. 48) 42Dem folgt unser empirischer Beitrag. Dabei sollte man aber nicht stehen bleiben – Heimbrock ergänzt: „Von der Theologie her geht es dabei heute aber nicht um eine heimliche oder offene Verwässerung empirischer Forschung, nicht um weniger, sondern um mehr als ‚harte‘ Empirie.“ (ebd., S. 51) Es bleibe nämlich „die Frage:
Wie verhalten sich wissenschaftlich erhobene Daten von empirischer Einzelforschung zum Gesamtverständnis von Wirklichkeit.“ (ebd.) Denn wie „über Wirklichkeit und Leben gedacht“ werde, beeinflusse „in hohem Maße auch den praktischen Umgang mit Menschen“ (vgl. ebd., S. 59). Solch ein Gesamtverständnis wird in unserer Studie v. a. anthropologisch bedacht.
Der Theologe Richard Schröder gibt zu bedenken, dass man naturwissenschaftlichen Methoden – d. h. auch empirischen – keine „Allerklärungskompetenz“ zuschreiben dürfe. Themen wie etwa Gerechtigkeit, Frieden oder Freiheit und „unser gelebtes Selbstverständnis mitsamt unseren lebensweltlichen Erfahrungen und lebensleitenden Überzeugungen“ bräuchten „andere Weisen des Wissens“ (vgl. Schröder 2011, S. 56) f.). 43Dabei erinnert er daran, „dass jenseits der naturwissenschaftlichen Forschung nicht das freie Feld des wilden Mutmaßens beginnt, sondern auch dort die Sorgfalt des Denkens, der Wahrnehmung und des Unterscheidens unerlässlich ist.“ (ebd., S. 9) Wolfgang Schoberth verweist auf den notwendigen methodischen Reduktionismus von Wissenschaften, der mit Erfolg komplexe Wirklichkeiten auf einzelne Phänomene und Faktoren reduziere – das Menschsein als mannigfaltiges Ganzes sei damit aber noch nicht hinreichend erfasst (vgl. Schoberth 2006, S. 15) u. 134). 44Thema der Anthropologie sei nun „nicht ‚der Mensch‘, sondern der Diskurs über den Menschen“, gerade weil die unterschiedlichen „Vorstellungen vom Menschsein“ unser Handeln mit bestimmten (vgl. ebd., S. 83). Christian Thies und Eike Bohlken stellen sich eine integrative Anthropologie vor, die Ansätze für disziplinübergreifende Projekte biete wie auch kritisch gegen übertriebene „Alleinvertretungs- oder Letztbegründungsansprüche“ einzelner Disziplinen stehe: „Als zentraler Richtpunkt dient ihr die in offenen Leitbegriffen anzudeutende Mehrschichtigkeit und Vieldimensionalität der Menschen, die Raum lässt für universale und partikulare Merkmale und Praktiken.“ (Bohlken u. Thies 2009, S. 6) f.) Und damit auch für die Dimension von Religiosität bzw. Spiritualität. Nach Thies kann (philosophische) Anthropologie Orientierungswissen bieten, d. h. „begründete und systematisierte Einsichten, die helfen können, sich in einer unübersichtlichen, vieldeutigen Welt zurechtzufinden. Das gilt vor allem für wichtige Handlungsbereiche wie Medizin, Pädagogik und Politik.“ (Thies 2004, S. 11) 45
Der Psychologe Jürgen Kriz hält im Blick auf Psychotherapie die zugrunde liegenden Denkmodelle für sehr wichtig: „Die Fragen danach, wie wir leben wollen, was wir für wesentlich erachten, aus welchem Bild vom Menschen wir die Maximen unseres Handelns ableiten, etc. betreffen daher nicht nur das therapeutische Handeln selbst, sondern auch dessen Erforschung.“ (Kriz 2012, S. 29) Aus medizinethischer Sicht meint Ulrich H. J. Körtner, „Medizin, Pflege, Philosophie und Theologie“ müssten „stärker miteinander ins Gespräch kommen […], und zwar nicht nur auf dem Gebiet einer im wesentlichen auf Risikoabschätzung reduzierten medizinischen Ethik, sondern auch im Bereich anthropologischer Grundfragen.“ (Körtner 2014, S. 353) Zu solchem Gespräch möchte diese Studie einen qualifizierten Beitrag leisten.
1.7 Kontext Versorgungsforschung
Zur Einordnung der vorliegenden Studie in die medizinische Forschungslandschaft bietet sich besonders das Paradigma der Versorgungsforschung an.
Seit einigen Jahren ist die Versorgungsforschung ein innerhalb der Gesundheitsforschung etabliertes und anerkanntes eigenes Forschungsgebiet (vgl. Grenz-Farenholtz et al. 2012, S. 606). Angesichts begrenzter Mittel eine hohe Qualität der Kranken- und Gesundheitsversorgung sicherzustellen, gleiche oft einer Quadratur des Kreises: Dafür bräuchten alle Beteiligten einschlägiges Wissen, was die Versorgungsforschung mit entsprechenden Darstellungen des Ist-Zustands fördern wolle (vgl. Pfaff et al. 2011, S. XIII). In den USA kann sie auf einen sehr viel längeren Forschungszeitraum zurückblicken, als „Geburtsjahr“ wird dort das Jahr 1952 betrachtet, die offizielle Bezeichnung Health Services Research entstand aber erst 1960. In Deutschland kam sie erst ab den 90er-Jahren verstärkt auf (vgl. Grenz-Farenholtz et al. 2012, S. 606). Derzeit sei das Interesse an der Thematik Versorgungsforschung in Deutschland sehr groß, wie auch die zahlreichen Aktivitäten im Deutschen Netzwerk Versorgungsforschung (DNVF) zeigten (vgl. Schrappe u. Pfaff 2011, S. 384). 46
In Deutschland hat sich folgende Definition der Versorgungsforschung allgemein durchgesetzt (vgl. ebd., S. 381):
Versorgungsforschung kann definiert werden als ein fachübergreifendes Forschungsgebiet, das die Kranken- und Gesundheitsversorgung und ihre Rahmenbedingungen beschreibt und kausal erklärt, zur Entwicklung wissenschaftlich fundierter Versorgungskonzepte beiträgt, die Umsetzung neuer Versorgungskonzepte begleitend erforscht und die Wirksamkeit von Versorgungsstrukturen und -prozessen unter Alltagsbedingungen evaluiert. (Pfaff 2003, S. 13) 47
Ihr Gegenstand sei die „letzte Meile“ des Gesundheitssystems, darunter sei „die konkrete Kranken- und Gesundheitsversorgung in den Krankenhäusern, Arztpraxen und sonstigen Gesundheitseinrichtungen zu verstehen, in deren Rahmen die entscheidenden Versorgungsleistungen zusammen mit dem Patienten erbracht werden.“ (ebd., S. 13) f.) Mit Krankenversorgung ist „die Betreuung, Pflege, Diagnose, Behandlung und Nachsorge eines kranken Menschen durch medizinische und nicht-medizinische Anbieter von Gesundheitsleistungen“ gemeint, sie umfasst also sowohl die medizinische wie auch die psychosoziale Versorgung der Patienten (vgl. ebd., S. 14). Eine entscheidende Perspektive ist dabei deren Betrachtung unter Alltagsbedingungen .
Читать дальше