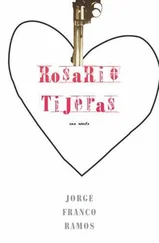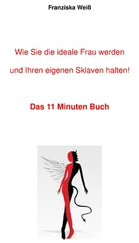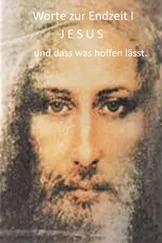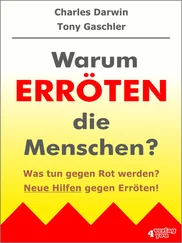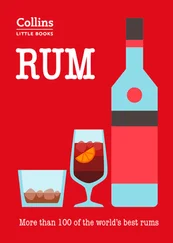Die nötige Transparenz und eine berechtigte Vorsicht sind jedoch zu unterscheiden von unfairen Verdächtigungen. Der Weg von kritischer Sicht hin zu Verdacht oder gar Vorurteilen ist manchmal nicht weit. Matthias Richard vermutet, religionspsychologische Forschung sei in Deutschland unter anderem deshalb selten, weil „dem Forscher schnell unterstellt wird, den Inhalt einer religiösen Aussage belegen zu wollen und damit ‚weltanschaulich gebunden‘ zu sein.“ (Richard 2004, S. 131) Peter J. Verhagen sieht die im Bereich von Psychiatrie und Religion forschenden Wissenschaftler unter dem Verdikt stehend, religiös stark interessiert zu sein. Sie würden damit eines Interessenkonfliktes beschuldigt, und man fürchte eine Evangelisierung von Patienten und die Gefahr der Verletzung therapeutischer Grenzen (vgl. Verhagen 2012, S. 355). Prominent haben das etwa in Großbritannien die Psychiater Rob Poole und Robert Higgo vertreten, die bei einigen Forschern einen Interessenkonflikt in Form eines starken religiösen Glaubens oder einer formalen religiösen Rolle annehmen (vgl. Poole u. Higgo 2011, S. 26). 31Fiona Timmins et al. haben den Eindruck, Forscher zu Religion und Spiritualität würden bereits aufgrund ihres Themas höheren Standards und Erwartungen unterworfen als andere Forscher (vgl. Timmins et al. 2016, S. 4). Niedrigere Standards sollten es aber keinesfalls sein.
Benannt werden müsste in diesem Kontext auch eine gegenteilige Tendenz. Klaus Baumann verwies auf Tendenzen zu wissenschaftlichem (Neo-)Positivismus, Materialismus und Empirizismus, die in den Neurowissenschaften, Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapien verbreitet seien. Professionelle Neutralität dürfe aber nicht als „wertfreie“ Wissenschaft konzipiert werden wie vom Empirizismus behauptet, der aber selber mit zumindest impliziten ideologischen Optionen und Wertentscheidungen geladen sei – gegen Metaphysik und Religion und zugunsten von materialistischem Reduktionismus (vgl. Baumann 2012, S. 107) f.). 32Weder ein unwissenschaftlicher generell negativer Bias noch eine unkritisch positive Haltung zu Religiosität bzw. Spiritualität seien wünschenswert (vgl. ebd., S. 112). Gleichwohl sei radikaler Reduktionismus generell eine Versuchung für die Psychologie – und Religion für reduktionistische „Nichtsals“-Erklärungen gefährdeter als andere menschliche Phänomene, meint K. I. Pargament unter Berufung auf den namhaften Religionspsychologen David M. Wulff (1996) (vgl. Pargament 2002a, S. 243).
Sowohl die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF 2010b) wie das Deutsche Netzwerk evidenzbasierte Medizin (2011) gaben Empfehlungen zum Umgang mit möglichen Interessenkonflikten und damit der Verringerung von Bias (dt.: einseitige Neigung, Voreingenommenheit, systematischer Fehler). Beide Organisationen stützen sich auf ein international rezipiertes Bias-Risiko-Konzept von Interessenkonflikt, das von Dennis F. Thompson und Ezekiel J. Emanuel entwickelt wurde und in die Konzeption des Institute of Medicine (US) eingeflossen ist: „Conflicts of interest are defined as circumstances that create a risk that professional judgments or actions regarding a primary interest will be unduly influenced by a secondary interest .“ (Lo u. Field 2009, S. 6). 33Interessenkonflikte sollten nicht „mit mangelnder Integrität einer Person gleichgesetzt werden“ – integer bezeichne als personale Eigenschaft Personen, die „nicht durch Fehlverhalten oder Korruption aufgefallen sind“ und dafür künftig keine hohe Wahrscheinlichkeit haben (vgl. Deutsches Netzwerk evidenzbasierte Medizin 2011, S. 7). Ein vorliegender Interessenkonflikt solle auch nicht „mit der Unterstellung einer verzerrten Entscheidung gleichgesetzt“ werden; angemessener sei das Bias-Konzept, welches das „Risiko für einen verzerrenden Einfluss auf professionelle Urteile einzuschätzen und explizit zu machen“ und präventiv zu minimieren suche (vgl. ebd., S. 8). Ein Interessenkonflikt sei also „bei Thompson und Emanuel nicht als ein Ereignis, sondern als ein Zustand mit einer Tendenz definiert“ und „die Wahrscheinlichkeit einer unangemessenen Beeinflussung durch Interessenkonflikte als ein Kontinuum (leichtgradig/schwergradig) zu verstehen“ (vgl. ebd., S. 9). „Die meisten Sekundärinteressen, inklusive finanzieller Vorteile, sind (innerhalb bestimmter) Grenzen absolut legitime Ziele. Sekundärinteressen werden dann problematisch, wenn sie einen unangemessenen Einfluss auf professionelle Entscheidungen haben.“ (ebd.) Eine wichtige Maßnahme, die Offenlegung ( disclosure) von Interessenkonflikten hat als Ziel: „Personen, die durch professionelle Entscheidungen betroffen sind, sollen ausreichend über Interessenkonflikte der Entscheider informiert sein. Standardmäßig sollte die Offenlegung das beinhalten, was die Betroffenen wissen müssen, um den Schweregrad des Interessenkonflikts einschätzen zu können“ (ebd., S. 15). So verlangt die AWMF im Rahmen der Leitlinienentwicklung, Interessenkonflikte zu erklären, wobei „materielle und immaterielle Interessen“ erfasst werden sollen (vgl. AWMF 2010b, S. 4). Das entsprechende Formblatt erfragt neben etlichen finanziellen Aspekten etwa folgende Punkte: „Politische, akademische (z. B. Zugehörigkeit zu bestimmten ‚Schulen‘), wissenschaftliche oder persönliche Interessen, die mögliche Konflikte begründen könnten. Gegenwärtiger Arbeitgeber, relevante frühere Arbeitgeber der letzten 3 Jahre“ (AWMF 2010a, Nr. 8 f.).
Alan C. Tjeltveit stellt in einem Überblicksartikel die Rolle von Werten in psychologischen wissenschaftlichen Untersuchungen und vorgeschlagene Lösungen für eine unberechtigte Präsenz von Werten aufseiten der Untersucher vor (vgl. Tjeltveit 2015, S. 35). Die eigenen Werte und Annahmen offen zu legen helfe Lesern, die Aussagen von Autoren zu interpretieren und verstehen – allerdings könnten statt Konsens und Horizontverschmelzung auch schädliche Folgen resultieren: Ablehnung oder Bestrafung von jenen, die eine bestimmte Sicht vertreten, nichtideale Gesprächssituationen usw. (vgl. ebd., S. 44) f.). In konkreten Forschungsprojekten gelte es, im Blick auf eigene Werte und möglichen Bias Expertise und praktische Weisheit zu kombinieren, etwa in angemessenen prozeduralen und statistischen Methoden – eine einfache allgemeingültige Lösung dafür gebe es nicht (vgl. ebd., S. 47) f.). Fiona Timmins et al. meinen, die meiste Forschung überhaupt würde angesichts der damit verbundenen Anstrengungen ohne den „Glauben“ und die Hingabe von Forschern an ihre Forschungsfragen nicht stattfinden – nötig sei jedoch ein Forschungsdesign, durch das die Resultate objektiv und nicht von persönlichen Neigungen beeinflusst würden (Timmins et al. 2016, S. 4).
Stephanie Klein weist darauf hin, dass alle Forschenden ihr eigenes „Relevanzsystem“ hätten, auf das ihre Erkenntnisse bezogen seien, sie müssten daher „ihren eigenen Referenzrahmen, d. h. ihre eigene biographische, soziokulturelle, geschlechtsrollenspezifische, kirchliche etc. Situiertheit“ reflektieren und benennen: „Dadurch wird den Erkenntnissen der Schein einer falschen Objektivität genommen und vielmehr die Reichweite der Gültigkeit der Aussagen benannt. [orig. mit Fußnote: Vgl. J. Habermas, Erkenntnis und Interesse] Die Reflexion auf eigene Prämissen und Interessen und ihre offene Darlegung sind deshalb als Kriterien von Wissenschaftlichkeit anzusehen.“ (Klein 1999b, S. 251) 34
Zusammen mit den oben genannten Empfehlungen heißt das für mich als Autor im Sinne einer ausführlichen Offenlegung von Interessen ( Declaration of interests): Ich verfasse diese Studie als katholischer Christ und Priester, universitär qualifiziert mit Lizentiaten der Theologie sowie der Psychologie, tätig sowohl in der Seelsorge wie auch als Psychologischer Psychotherapeut. 35Insofern durch die Doppelausbildung zumindest mit einer gewissen interdisziplinären Qualifikation ausgestattet. 36Inwieweit kann ich als kirchlicher Amtsträger wissenschaftlich neutral sein?
Читать дальше