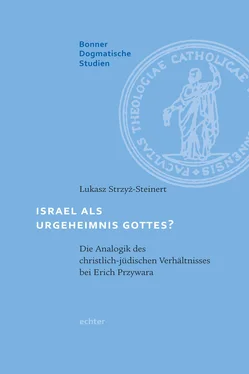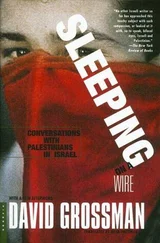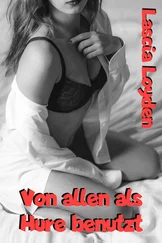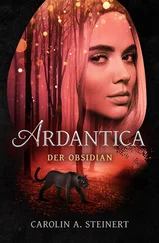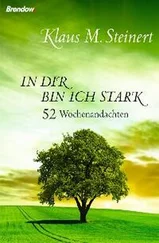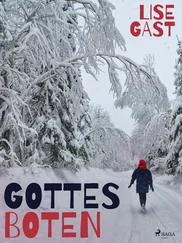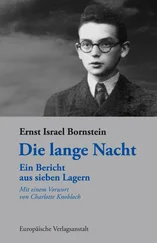1 ...6 7 8 10 11 12 ...27 Przywaras Werdegang im Jesuitenorden ist aufs Engste mit der Situation des deutschen Katholizismus verbunden, für den die deutsche Niederlage im I. Weltkrieg eine schöpferische Katastrophe zu sein schien. Die „Spannung zwischen einem vom Krieg erschütterten Dasein und notwendiger Sinndeutung“ 29führte zu vielen Aufbrüchen im deutschen Geistesleben, zu denen auch ein katholischer Aufbruch zählte. Bismarcks Kulturkampf verzögerte die gesellschaftliche Integration der Katholiken im Kaiserreich und erzeugte bei den katholischen Milieus eine generelle Abwehrhaltung gegen die Einflüsse der Außenwelt. Der Zusammenbruch der gesellschaftlichen Ordnung bewirkte aber, dass, wie Przywara schreibt, „die Schöpferkraft und die Lebenskraft unseres deutschen Katholizismus in einem Maße entbunden ist, wie es die Vorkriegsjahre nicht ahnen ließen“ 30. Der Katholizismus schien „auf einmal aus seinem Aschenbrödel-Dasein“ rauszukommen und zur „letzte[n] Mode‘“ 31zu werden. „Katholizismus war auf einmal das Schöpferische in dieser erschütterten Welt. Vier Jahrhunderte schienen versunken wie ein böser Traum. Die ‚katholische Lebensform‘ leuchtet auf einmal wie als die allein mögliche“ 32.
Przywara beruft sich auf den Eindruck einer „katholischen Wende“ im deutschen Geistesleben. Diese Jahre um den I. Weltkrieg sind Zeugen von ‚prominenten‘ Konversionen einiger Vertreter der Kultur und Wissenschaft, wie Hugo Ball, Edith Stein und – was den größten Einfluss auf das neue katholische Bewusstsein ausübte – Max Scheler. In dieselbe Periode fallen auch Entstehungen von innerkatholischen Erneuerungsbewegungen wie die Liturgische Bewegung und die Jugendbewegung. In Anlehnung an das famose, die Atmosphäre der Jahre wiedergebende Wort Guardinis, schreibt Przywara: „Guardini sprach vom ‚Erwachen der Kirche in den Seelen‘. Man könnte noch schärfer sagen ‚Erwachen der Seelen zur Kirche‘“ 33.
Przywara sieht seine Aufgabe darin, diesen Aufbruch kritisch zu begleiten. Der so lange marginalisierte deutsche Katholizismus muss sich erst als schöpferische Kraft bewähren, über seinen Minderwertigkeitskomplex, sein „Pariabewußtsein“ 34, hinwegkommen und den notwendigen Selbstfindungsprozess durchmachen. Statt aus dem Geist der wahren Katholizität zu schöpfen, meinten die Katholiken allzu oft, sich dem Zeitgeist angleichen zu müssen, um sich Geltung zu verschaffen. Oder die Haltung schlug um in einen reinen Protest gegen die zeitgenössische Kultur, um aber auch auf diesem Weg von ihr gänzlich abzuhängen.
Mit der Zeit werden Przywaras Töne immer nüchterner, da die nicht ausgestandenen Probleme und Spannungen, die die Kirche vor dem Krieg erschütterten, sich unter der Decke der Euphorie auf bedenkliche Weise auszuwirken beginnen, um zur Krise zu führen. Die Kirche, statt die vielbeschworene schöpferische Kraft im Aufbau einer neuen Kultur und Gesellschaft zu sein, verzettelt sich im Kampf um Selbsterhaltung. Die Debatten münden nicht in einer wachsenden Einheit in Vielfalt, sondern in Zerreißung. Die größte Hoffnung des Nachkriegskatholizismus, Max Scheler, distanziert sich von den eindeutig katholischen Positionen und wird zum Abgefallenen. Der vielgelesene Theologe Joseph Wittig wurde wegen seiner modernistischen Ideen exkommuniziert.
Auch Przywara persönlich leidet unter der Zerrissenheit, die bis in seinen Orden hineinreicht, der, im Kulturkampf bekämpft, lange Zeit als die Speerspitze des Ultramontanismus galt. Als die antikirchlichen Gesetze nach dem I. Weltkrieg gänzlich aufgehoben wurden und die Jesuiten in Deutschland ganz Fuß fassen konnten, begann die alles andere als reibungslos verlaufende Neuausrichtung, die einerseits mit der neuen gesellschaftlichen Stellung in Deutschland, andererseits mit der gesamtkirchlichen Situation zurecht kommen musste. Galt für Przywara „das geistige Spanien“ des hl. Ignatius als „Aug in Aug“ zur Reformation, dem verhängnisvollen Riss im Abendland 35, so mündete zu Beginn des 20. Jahrhunderts die lange Epoche des Pontifikats Pius X. „in den vielleicht gefährlichsten Riß innerhalb der Kirche: den Riß zwischen Modernismus und Integralismus“ 36. Die Situation der Zeitschrift „Die Stimmen der Zeit“, bei der Przywara bis 1941 einer der Redakteure war, mag für die Problematik der Situation der Kirche in der modernen Welt symptomatisch stehen 37.
Die 1871 als „Stimmen aus Maria Laach“ gegründete Zeitschrift verfolgte im Wilhelminischen Reich eine klare ultramontane und antimodernistische Linie. Vielen Jesuiten der Weimarer Zeit wurde jedoch klar, dass die neue, viel differenziertere gesellschaftliche und geistige Lage, in der sich die Kirche nun befand, sowie die tatsächlichen Fragen, die einerseits die Moderne, andererseits aber auch der Modernismus aufgeworfen hatten, eine Neuorientierung erforderten. Die kirchliche Fixierung auf den antimodernistischen Kampf hatte eine Ghettoisierung und Abwehrhaltung zur Folge, die die Kirche unfähig machten, auf die tatsächlichen Herausforderungen geistigintellektueller Natur zu reagieren. So wollten die für die „Stimmen der Zeit“ Verantwortlichen, gemäß dem ignatianischen Ideal einer klugen Unterscheidung der Geister, „weder Modernisten sein, noch sich auf das Programm des Thomismus der 24 Thesen aus den letzten Jahren Papst Pius‘ X. festlegen lassen“ 38. Sie versuchten die Verhärtung zwischen den Extremen zu überwinden und einen Mittelweg zu gehen, um so eine fruchtbare Kontroverse mit der modernen Welt zu suchen und sich in der Gesellschaft positiv einzubringen.
In einigen klerikalen Kreisen erhoben sich allerdings Stimmen der Unzufriedenheit, dass die Zeitschrift mehr problematisiert, „als katholische Sicherheit und Klarheit vermittelt, wie man es von ihnen erwarte und von früher gewohnt sei“ 39. Ins Visier des Generals des Jesuitenordens Włodzimierz Ledóchowski gerieten unter anderem Przywaras Ansichten über Max Scheler. Nach Konsultationen mit Theologen ließ er seine Meinung wissen, „Przywara versuche Scheler gewaltsam zu retten und verteidige auf diese Weise gefährliche und objektiv falsche Positionen. Er wundere sich, wie diese Zeitschrift durch die Zensur gegangen sei“ 40. Der Provinzial Augustin Bea antwortete dem General, dass der Nuntius Eugenio Pacelli „ihm gegenüber in den höchsten Tönen von Przywara gesprochen habe: Er habe alle seine Werke gelesen und sei sehr einverstanden mit der Weise, wie Przywara mit den Gegnern umgehe“. Bea will Przywara aber auch mündlich ermahnt haben, „seinen ‚pruritus scribendi‘ (‚Schreib-Juckreiz‘) zu zügeln“ 41. Nichtsdestotrotz forderte der Ordensgeneral einige Jahre später einen speziellen Zensor für Przywara, der dieser Aufgabe „eher zu streng als zu milde“ 42nachzugehen hatte.
Przywara kam mit dieser Art des Umgangs überhaupt nicht zurecht. Er sah sich „einmal zwischen zwei Stühlen: In Deutschland gelte er als ‚römisch‘, da er als einer der ersten gegen Wittig Stellung bezogen habe, in Rom sei er aber jetzt plötzlich nicht mehr orthodox“ 43. Da seiner Meinung nach dem Zensor jedes Verständnis für seinen Auftrag, sich auf die modernen Fragen und Strömungen zu beziehen und nicht nur einer schulmäßigen Theologie zu folgen, fehle, drohte Przywara unter diesen Bedingungen nicht mehr schreiben zu wollen. Schließlich musste aber der Ordensgeneral von seiner Absicht Abstand nehmen und den Zensor widerrufen.
Die andere Seite der Medaille der innerkirchlichen Spannung zeigte sich in Przywaras Kontroversen um die Kierkegaard- und Newmandeutung, die zwischen den Vertretern eines traditionellen (im damaligen Sprachgebrauch eines scholastischen und jesuitischen) und eines kritischen Katholizismus ausgetragen wurde. „Ein führender Geist der ‚kritischen Katholiken‘ sagte mir“ – schreibt Przywara – „auf einer gemeinsamen Fahrt einmal offenherzig: Wir haben das gegen Sie, daß Sie die Geister, die wir gegen einen jesuitischen Katholizismus stellen möchten, Kierkegaard und Newman, ‚umjesuitieren“ 44.
Читать дальше