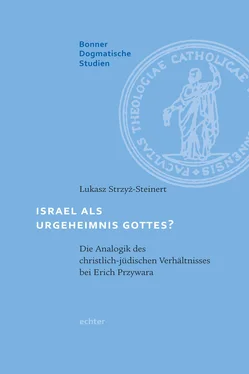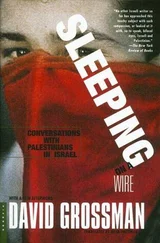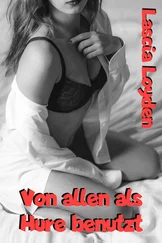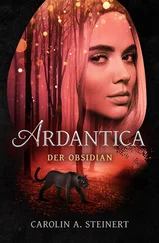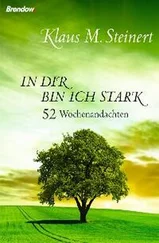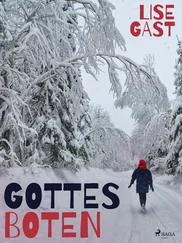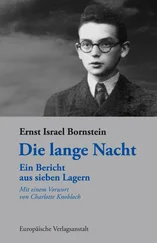24Siehe auch P.S. PETERSON, Anti-Modernism; DERS., The Early Hans Urs von Balthasar , bes. 11–22 u. 185–214.
25Nach der Fertigstellung meiner Arbeit fand diese Debatte tatsächlich ihre Fortsetzung. In: A. PIDEL, Erich Przywara , wird Peterson mangelnde Differenzierung und unzulängliche Hermeneutik im Umgang mit Przywaras Texten vorgeworfen. Durch nuancierte Lektüre von Przywaras umstrittenen Aussagen meint Pidel Petersons Thesen widerlegen und ihn als einen gewieften Opponenten der faschistischen Ideologie darstellen zu können. Auch J. Negel geht auf Petersons ersten Artikel ein und bemängelt, dass Peterson einen diachronischen Lektüreansatz verweigert, was dazu führt, dass er Przywara als einen typischen Vertreter „der sogenannten ‚Konservativen Revolution‘ der 1920er und 30er Jahre“ darstellt. „Petersons Text, der Przywara schon vom Ansatz her kaum gerecht werden kann, durchzieht ein denunziatorischer Ton, der ärgerlich ist“, fügt Negel hinzu (J. NEGEL, Nichts ist wirklicher , 223, Anm. 136). Daraufhin meldet sich wieder Peterson zu Wort (P.S. PETERSON, A third time) und bekräftigt seine These durch weitere Bespiele von Przywaras Zitaten, durch die er die Affinität zum faschistischen und nationalsozialistischen Gedankengut zweifellos zu belegen glaubt. Pidel und Betz wirft er apologische Absichten, die die dunkle zeitgeschichtliche Realität ausklammern wollen, vor (bes. ebd. , 203, Anm. 3). Gegen Negel verteidigt er die historisch-kritische Richtigkeit seines synchronischen Ansatzes (vgl. ebd. , 208f, Anm. 15). Als besonders desavouierend betrachtet Peterson Przywaras Korrespondenz mit Carl Schmitt. Sein Fazit über Przywara und die ganze katholische theologische und religionsphilosophische Produktion aus dieser Epoche: “Perhaps something can be redeemed from the older works of the 1920s, 1930s and 1940s. On the whole, however, much of this philosophy of religion (and legal theory) is simply an expression of the intellectual world of fascism“ (ebd., 239, Anm. 127). Mein Fazit über diese so wichtige Debatte: Es ist bedauerlich, dass der denunziatorische Eifer hier so bestimmend wird; eine redliche Auseinandersetzung wird dadurch nicht erleichtert. Peterson legt den Finger in viele Wunden, die aber konsequent und behutsam behandelt werden müssen. So korrespondiert Przywara z.B. in dieser Zeit nicht nur mit C. Schmitt, sondern auch mit L. Baeck und J. Taubes. Wie erklärt sich diese Widersprüchlichkeit (siehe dazu z.B. unter 1.3 in meiner Arbeit)? Seine Polemik gegen die Idee der Humanität der Aufklärung und sein Bestehen auf den „qualitativen Unterschiede[n]“ zwischen Geschlechtern und Völkern (vgl. ebd. , 221) hängen zusammen mit seiner Vision von „Juden und Heiden“ als einer in Alterität existierenden Menschheit (siehe dazu z.B. 2.4.4 in vorliegender Arbeit). Natürlich haben diese Gedankengänge ihre Schwächen und können zur Begründung von falschen Ideologien missbraucht werden – aber die Probleme liegen viel tiefer, als es Petersons polemische Artikel erahnen lassen. Hoffentlich können die Ergebnisse meiner Arbeit zu einer konstruktiven Debatte beitragen.
26CH. KÖSTERS, Katholische Kirche , 26.
1. Erich Przywara – der Denker und seine Welt1
Die Welt, in der Erich Przywara lebte, wirkte und dachte, war eine Welt der Brüche und Gegensätze. Der Grundimpetus von Przywaras Denken ist die Suche nach dem Einen, in dem das Vielfältige und Widersprüchliche begründet ist. Dieser Einheitsgrund ist das rechte Verhältnis, in dem alles zueinander steht. Da Erich Przywaras philosophisch-theologisches Werk und seine Existenz „wie kaum bei einem zweiten Theologen“ 1seiner Epoche zusammengehören, ist auch seine Beschäftigung mit dem Jüdischen und dem christlich-jüdischen Verhältnis ohne die enge Verschlingung mit seiner Zeit und Umwelt, wie auch ohne Przywaras eigenwilliger Persönlichkeit, nicht zu verstehen. Die symbolischen Orte, die für Erich Przywaras Welt und seine eigene existenzielle Verortung stehen, sowie die Koordinaten seines Denkens seien nun skizziert.
1.1 Welt der Brüche und Gegensätze
1.1.1 Gegensätzliche Geburtserde
Dem oberschlesischen Industriebezirk, in dem „alle Gegensätze sich schnitten“ 2, verdankte Erich Przywara seine erste und damit für die weitere Entwicklung grundlegende Formung. Am 12. Oktober 1889 in Kattowitz geboren, wurde Przywara von Kindesbeinen an mit einer Stadt konfrontiert, die symptomatisch für die Gegensätze und Widersprüche seiner Epoche stehen kann. Im Zuge der rasanten Industrialisierung Oberschlesiens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stieg Kattowitz binnen weniger Jahrzehnte vom Dorf zum Zentrum des oberschlesischen Industriebezirks auf. Es war keine organisch gewachsene Einheit, sondern eine im Geist des Positivismus künstlich angelegte Stadt. „Es war darum eigentlich nicht ‚Erde‘, sondern Kohlen-Halden-Boden“, auf dem ein kalt nüchterner „Realismus von Grube, Fabrik, Handelskontor“ 3herrschten. Den Geist dieser Entwicklung bekam Erich Przywara aus nächster Nähe zu spüren, da der Alltag in seinem Elternhaus dem Geschäft des Vaters, eines begabten und leidenschaftlichen Kaufmanns, gänzlich untergeordnet 4und somit durch „das rechnerisch Nüchterne der Atmosphäre von Kattowitz“ 5zutiefst geprägt wurde.
Umgeben wurde diese Stätte eines entzauberten Realismus und harter Arbeitsbedingungen von tiefen, vom großen schlesischen Romantiker Joseph von Eichendorff besungenen, Wäldern, in derer unendlichen Weite Przywara aufatmen und eine ganz andere Welt erleben konnte: „Unendlichkeit, Wildnis, Zauber, Nacht“ 6. Das ist also der erste Gegensatz, dem Przywara ins Gesicht schaut: „So stark das Abgründig-Nächtige echter Romantik im Oberschlesien der Wälder lebt, ebenso stark wirkt ein schroffer rationalistisch nüchterner Technizismus im Oberschlesien der Hütten und Gruben“ 7. In Przywaras Welt stehen sich die Gegensätze in ihrer reinen Form gegenüber und es fehlt zwischen ihnen an einer vermittelnden und abmildernden Instanz.
Es ist eine unruhige Welt. Der rasante Fortschritt machte das bis hinein ins 19. Jahrhundert industriell zurück gebliebene Deutschland binnen einiger Jahrzehnte zu einer der führenden kapitalistischen Weltwirtschaften. Wie G. Aly beschreibt, verlief dieser Prozess jedoch „in immer rasanteren, den meisten Deutschen zu harten, zu schnellen Rhythmen“ 8, was sich in sozialen, tief in das Bevölkerungsgewebe und kollektive Bewusstsein reichenden Verunsicherungen und Spannungen auswirkte. Die Modernisierungsschübe überschlugen sich mit ökonomischen und politischen Krisen, denen sich viele Menschen wehrlos ausgeliefert fühlten.
Przywara ist Kind seiner Zeit, deren Grundgefühl im Existenzialismus ihren Ausdruck fand. Alles ist im Fluss, der Mensch bebt von Unruhe. Hoffnung und Angst, Fortschrittsenthusiasmus und Resignation geben sich die Klinke. Das Sein überhaupt wird durch seine Nichtidentität, nicht durch Seinsgewissheit, definiert. Die beruhigten, statischen Strukturen des anthropozentrischen Idealismus entlarvten sich spätestens im Zuge des I. Weltkriegs als nicht tragfähig. Die Unruhe ist das Welterlebnis, von der her Przywara das Ganze betrachtet. Er nimmt sie ernst und diskreditiert sie nicht, als ob sie nur eine Art Störung wäre. Die Unruhe ist bedrohlich, aber sie offenbart etwas Wesentliches.
Johann Wolfgang Goethe, der Schlesien 1790 bereiste, nannte es ein „zehnfach interessante[s] Land“ und „Brückenlandschaft“ zwischen West- und Osteuropa 9. Przywaras Familienhaus illustriert diese Begegnung und das Miteinander, da sein Vater aus einer polnischen Bauernfamilie, seine Mutter hingegen aus einer deutschen Beamtenfamilie aus Neiße stammte. Der Oberschlesier, schreibt Przywara, „spürt immer gleichzeitig die Gegenseite im eigenen Blut“ 10, was ihn vor Einseitigkeit hütet, und zur „Brücke“ werden lässt, vorausgesetzt „er erkennt und anerkennt seine Aufgabe“ 11. Die Suche nach der Geisteseinheit zwischen Ost und West begleitet ihn lebenslang als die Herausforderung der Gegenwart schlechthin und wird ihm zur Chiffre der Einheit vor allem im Kontext seiner Begegnung mit dem Judentum.
Читать дальше