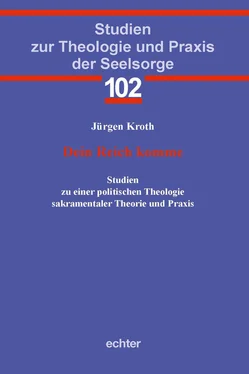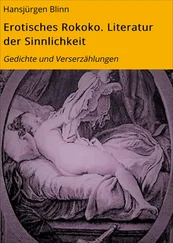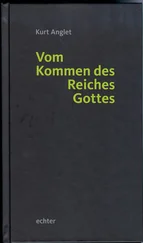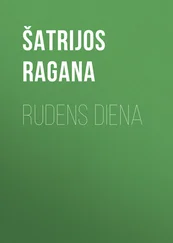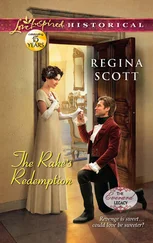2
Der zweite Teil der Studie konzentriert sich auf die Herausarbeitung einer politischen Theologie der Sakramente. Diese Konzentration und die praktisch-theologische Fragestellung dieser Arbeit legen schon nahe, dass hier nicht das gesamte Spektrum sakramententheologischer Ansätze zum Gegenstand gemacht werden soll. Allenfalls können paradigmatisch einige grundlegende diskutiert werden. Zuvor aber ist es notwendig, den hier als zentral erachteten Topos der Sakramententheologie genauer zu erkunden, also der Frage nach dem Stellenwert der Reich-Gottes-Botschaft in den biblischen wie systematischen Traditionen nachzugehen (Kap. 5), um dann das Verhältnis von Welt und Reich Gottes genauer bestimmen zu können (Kap.6). Zu fragen ist, ob und wenn ja mit welchen Referenzsystemen die Theologie überhaupt in der Lage ist, Welt als Welt anzuerkennen, ohne dabei völlig in der Welt aufzugehen. Es wird dabei deutlich werden, inwieweit auch solch bahnbrechende Ansätze wie der einer transzendentaltheologisch fundierten anthropologischen Theologie nicht hinreicht, die Weltlichkeit der Welt theologisch zu entfalten. Vielleicht ist hier doch zu viel Hegelsche Universalgeschichte am Werke, die letztlich jenen χωρισμός zu überwinden trachtet, den die Kantische Philosophie noch markierte. Wie aber ist sonst theologisch das Weltverhältnis zu bestimmen? Am ehesten dadurch, dass der Blick ungetrübt die Welt wahrnimmt und sehr vorsichtig ist mit allzu schnellen theologischen Suppositionen. Das mahnt schon das berühmte Diktum Adornos,
Erkenntnis habe „kein Licht, als das von der Erlösung her auf die Welt scheint: alles andere erschöpft sich in der Nachkonstruktion und bleibt ein Stück Technik“, das dann aber verschärfend fortfährt: „Perspektiven müßten hergestellt werden, in denen die Welt ähnlich sich versetzt, verfremdet, ihre Risse und Schründe offenbart, wie sie einmal als bedürftig und entstellt im Messianischen Lichte daliegen wird.“ 17
Die kirchlichen Sakramente sind – recht verstanden – Widerspiegelung eines nicht-heilen Lebens in der Hoffnung, dies möge anders werden (Kap. 7). Sie sind Ausdruck der Hoffnung auf universale Versöhnung im Stande des Nichtidentischen, unterwerfen sich diesem jedoch nicht, sondern suchen praktische Veränderung, auch und nicht zuletzt, indem sie die Möglichkeit von Versöhnung antizipieren. So wahr der Satz, es gebe kein richtiges Leben im falschen 18auch ist, so falsch wird er, wenn daraus gefolgert wird, alles könne so bleiben, wie es ist, da es eben kein richtiges Leben gebe. Immerhin hat schon Walter Benjamin mit großem Recht darauf hingewiesen, die Katastrophe bestehe darin, dass alles so weitergehe. 19Eine politische Theologie der Sakramente (Kap. 8) knüpft an solchen Einsichten an und weiß sich dabei zugleich getragen von der jüdisch-christlichen Tradition, deren eschatologisch-apokalyptischer Grundgestus sich ebenfalls nicht damit abfinden kann, dass das, was ist, alles sei, dass es also mehr geben müsse als das, was der Fall ist. Unverkennbar ist somit auch schon, welche außertheologischen Referenzen für die Entfaltung der Fragestellung wichtig sind: es sind wesentlich Reflexionen aus dem Umfeld der Kritischen Theorie. Es braucht angesichts der Rezeptionsbreite und –tiefe der Arbeiten von Horkheimer, Adorno, Benjamin und Habermas in der Theologie im Allgemeinen, der Politischen Theologie im Besonderen keine eigene Rechtfertigung für ein solches Vorgehen. Zudem hat die Arbeit von Franz Schupp 20schon fruchtbare Erkenntnisse eines Gesprächs zwischen Sakramententheologie und Kritischer Theorie geliefert. Dennoch soll auf diese Traditionslinie wenigstens in einem Bereich noch etwas intensiver eingegangen werden, nämlich in der Verhältnisbestimmung von Theologie und Praxis. Immerhin beansprucht die vorliegende Studie, einen Beitrag zu einer fundamental praktischen Theologie der Sakramente zu liefern. Es soll daher dieser Frage gerade auch unter Rekurs auf außertheologische Referenzen nachgegangen werden (Kap. 9).
3
Gewiss, das alles ist in der konkreten Sakramentenpastoral heute nicht erkennbar. Möglicherweise braucht es „zukünftig eine stärker inhaltsbezogene Reflexion und Konzeption kirchlichen Handelns“ 21. Es wird zu zeigen sein, dass diese Aspekte grundlegend sind für ein zeitgemäßes und zugleich in der Tradition verankertes Verständnis sakramentaler Praxis. Es wird im dritten Teil darum gehen, die einzelnen Sakramente unter Konzentration auf die Initiationssakramente ob ihrer Reich-Gottes-Relevanz sowohl zu befragen, wie diese auch auf der Höhe der Zeit zu formulieren. Vielleicht mag es enttäuschen, dass unmittelbar pragmatische Fragestellungen erst so spät im Verlauf einer praktisch-theologischen Arbeit auftauchen. Und vielleicht ist die Enttäuschung stärker, insofern keine unmittelbar anwendbaren oder umsetzbaren Ergebnisse geliefert werden. Es ist das Anliegen dieser Studie, eine politische Theologie sakramentaler Praxis zu entwerfen, nicht aber diese Praxis selbst abzubilden. Es gilt auch hier zu bedenken: Die Theologie ist actus secundus und reflexus, keineswegs unmittelbare pastorale Praxis, gleichwohl aber doch immer als Praxistheorie für die ihr vorgängige Praxis relevant. 22Insofern werden Kategorien entwickelt, die, aus der pastoralen wie allgemeinen Praxis und der theologischen Theorie gewonnen, in diese zurückfließen.
4
Gerade hinsichtlich des vorigen Punktes sind einige Bemerkungen zur Methode notwendig, die dieser Untersuchung zugrunde liegt: Es gilt, das Verhältnis von Theologie und Praxis etwas genauer zu bestimmen. Die folgenden Ausführungen können jedoch zwei Dinge nicht leisten: sie können nicht ersetzen, diese Methode immer wieder auf neue Situationen hin zu aktualisieren, so dass also alle Akteure in einem pastoralen Handlungsfeld immer wieder eine methodisch geleitete Sitautionsvergewisserung vornehmen müssen; sie können auch nicht in Anspruch nehmen, mit diesen wenigen Anmerkungen schon eine Theorie des Verhältnisses von Theorie und Praxis zu leisten. Insofern können hier nur Marginalien zu Theologie und Praxis formuliert werden.
Es mag vielleicht wie eine Anmaßung erscheinen, dies in so enger Anlehnung an einen Text von Theodor W. Adorno zu formulieren 23, allerdings ist dies in mehrfacher Hinsicht gerechtfertigt: zum Einen kann es sich auch hier angesichts der Breite des Themas und der Relevanz der Fragestellung nur um Marginalien handeln, die jeweils eigene Untersuchungen nötig machten, die ja in mehrfacher Form auch schon vorliegen 24, zum Anderen aber verdanken sich viele Überlegungen der vorliegenden Untersuchungen ohnehin grundlegenden Erkenntnisse der Kritischen Theorie im Allgemeinen, den Arbeiten von Adorno im Besonderen. Freilich ist der Kontext der Frage nach Theorie und Praxis, bzw. Theologie und Praxis ein deutlich anderer; dennoch können Adornos Überlegungen immer noch interessante und wichtige Gesichtspunkte liefern. Es wird daher unter (1) zunächst eine Rekonstruktion des Theorie-Praxis-Verhältnisses vor allem unter Rekurs auf die Philosophie versucht, auch um dem vor allem in der Praktischen Theologie starken Rückgriff auf das Verständnis von Theorie und Praxis von Jürgen Habermas ein kleines, aber notwendiges Korrektiv zur Seite zu stellen, woran sich anschließend unter (2) das in dieser Studie vorausgesetzte Verständnis von Theologie und Praxis noch einmal dezidiert entfaltet wird.
Praxis, im praktisch-theologischen Diskussionszusammenhang, ist ein plurale tantum. Was so leichtfertig behauptet wird, wiegt doch in der wissenschaftstheoretischen Diskussion um ein adäquates Verständnis von Praxis schwer. Kaum ein Lehrbuch und kaum eine praktisch-theologische Publikation, die mit der Frage umzugehen versucht, wo nicht betont wird, praktische Theologie sei Theorie der Praxis; und im gleichen Atemzuge wird gefragt: aber welcher Praxis?
Читать дальше