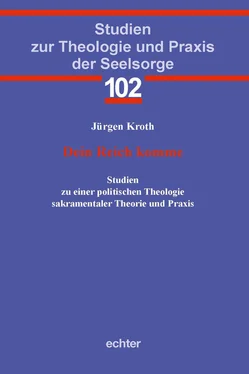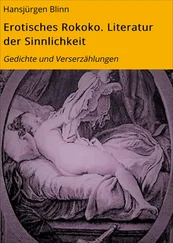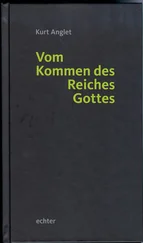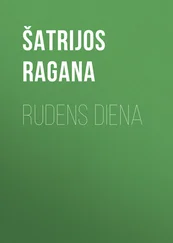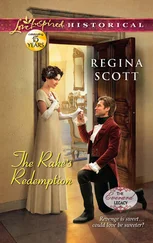Dem Bistum Trier, allen voran Bischof Dr. Stephan Ackermann, danke ich für die großzügige Gewährung eines Druckkostenzuschusses.
Niemals fertig geworden wäre diese Untersuchung ohne Melanie. Sie hat einen größeren Anteil an dem Endprodukt, als sie überhaupt nur einschätzen kann. Überaus großen Anteil aber haben auch Tiemo und Luise durch ihre bloße Existenz. Sie werden später verstehen, was damit gemeint ist. Diesen Dreien sei das vorliegende Buch in tiefer Dankbarkeit und Zuneigung – sie werden auch dies zu verstehen wissen – zugeeignet.
Einleitung und praktisch-theologische Grundlegung
Es wundert doch sehr, schaut man wachen Blicks in die sakramentenpastorale Wirklichkeit sowohl der theologischen Theoriebildung und Reflexion 1, aber auch der gemeindlichen Praxen, wie wenig die Vorbereitung auf die Feier von Sakramenten, wie wenig aber auch die Feiern selbst inhaltlich konturiert sind; erst recht ist das weitgehende Fehlen eines Reich-Gottes-Bezugs auffällig. 2Eine inhaltliche Fundierung in einer Reich-Gottes-Perspektive fehlt zumeist; 3von einigen Ausnahmen wird noch die Rede sein. 4Dies irritiert insofern umso mehr, als spätestens seit Evangelii nuntiandi von 1975 die Orientierung am Reich Gottes zentral für die Frage der Evangelisierung ausgegeben und damit lehramtlich, zumindest im Range eines Apostolischen Schreibens, aufgegriffen wurde (vgl. EN, 8-14). Auch angesichts des biblischen Befundes muss dies irritieren. Schließlich stellt die Verkündigung des Reiches Gottes „die entscheidende, zentrale Aussage der Botschaft Jesu insgesamt“ 5dar. Gleichwohl ist mit Jon Sobrino zu konzedieren, dass über viele hundert Jahre „weder Konzilien noch das Lehramt oder die Christologie das Reich Gottes im Sinn gehabt oder recht verstanden“ 6haben.
Die vorliegende Studie geht davon aus, dass gerade in den Sakramenten, die tatsächlich lebensrelevante Abschnitte markieren, etwas von dem aufscheinen muss, was einerseits als gelingendes Leben zu kennzeichnen ist, was aber andererseits die vorhandenen Möglichkeiten, das Leben als gelingend zu gestalten zugleich transzendiert und insofern eine Hoffnung artikuliert, die so radikal ist, dass sie mit dem Namen Gott und dessen Reich verbunden ist. So verstanden, haftet den Sakramenten eine ethische wie eine eschatologische Dimension an. Ja, es macht das Eigentümliche der Sakramente aus, dass in ihnen Ethik und Eschatologie zusammenfallen. Insofern eine bloß gleichsam nach vorn, in die Zukunft hinein verlagerte Hoffnung in der Gefahr steht, inhuman zu werden, eignet den Sakramenten zugleich eine anamnetische Tiefenstruktur.
Eine Auseinandersetzung mit den Sakramenten steht vor der Schwierigkeit, die vielfältigen theologischen Überschneidungen nicht außer Acht zu lassen zu dürfen, zugleich jedoch eine zielführende Fokussierung zu entwickeln. Dies bedenkend werden viele Schnittstellen zwar angesprochen; sie können aber nicht hinreichend ausgearbeitet werden. Der Schwerpunkt wird auf einer praktisch-theologischen, genauerhin pastoraltheologischen Perspektive liegen. Allerdings werden grundlegende Positionen der systematischen Theologie durchaus zu berücksichtigen sein. Es geht dabei nicht um eine weitere Arbeit zu dogmatischen Fragestellungen. Eher wird mit dem Rüstzeug einer „praktischen Fundamentaltheologie“ 7versucht, eine Vermittlung zwischen praktischer und systematischer Theologie auf der Basis der Sakramentenpastoral herzustellen. Dieses Verfahren wird schon deshalb als gerechtfertigt angesehen, weil jede Theologie als Wissenschaft immer einweisen muss in eine christliche Praxis. 8Selbstverständlich werden dabei auch dogmatische Fragen zu reflektieren, grundlegende ekklesiologische Unterschiede zu markieren und denkformanalytische Differenzen herauszuarbeiten sein. Gleichwohl stellt dies nicht das Hauptaugenmerk der Studie dar. Vielmehr soll die Sakramentenpastoral theologisch qualifiziert werden. Dabei ist sofort zu bedenken, dass in einer solchen theologischen Qualifizierung wesentlich von Gott und seinem Reich zu reden sein wird, ja, dass eine theologische Grundperspektive der Sakramentenpastoral ohne diese Perspektive in der Gefahr steht aufzuhören, Theologie zu sein. Wenn Karl Rahner davon ausgeht, eine Sakramententheologie benötige unabdingbar eine fundamentaltheologische Vergewisserung, „insofern Fundamentaltheologie die Wissenschaft ist, die sich die Dogmatik selbst als ihre eigene Grundlage voraussetzt“ 9, so wäre – unabhängig davon, ob die Fundamentaltheologie diese Zuschreibung unbefragt teilen könnte – wiederum gerade unter einem genuin theologischen Fragehorizont eine solch praktische Fundamentaltheologie hilfreich.
1
Für jede Theologie gilt, dass sie immer in einer bestimmten Zeit sich artikuliert. Auch für die Sakramentenpastoral und die Sakramententheologie gilt dieser Zeitindex. Bonhoeffer sprach davon, dass das, was immer wahr ist, gerade heute nicht wahr sein könne. 10Überzeitliche Positionen sind daher der Theologie Sache nicht, wenngleich es immer wieder – heute sogar wieder verstärkt 11– Tendenzen geben mag, solche zu finden. In der Sakramententheologie und der sakramentalen Praxis freilich lässt sich deutlich zeigen, wie sehr das jeweilige Verständnis auf zeitbedingte Erkenntnisse und Entdeckungen verweist. Es wird daher auch für diese Untersuchung zunächst darauf ankommen, etwas genauer zu verstehen, was denn pastoral und theologisch „der Fall ist“ (Kap. 1-3). Wenn solche Diagnosen versucht werden, dann selbstverständlich immer unter der Einschränkung der gewählten Fragestellung. Das erkenntnisleitende Interesse ist die Profilierung der Sakramentenpastoral als Einweisung in eine Reich-Gottes-Praxis. Das grenzt den zeitdiagnostischen Gestus notwendigerweise ein. Weniger wird es daher um das Hegelsche Anliegen gehen, die Zeit in Gedanken zu fassen 12, sondern darum die Gedanken und das Handeln der Menschen zeitgemäß zu erkunden. Das dafür beanspruchte methodische Instrumentarium ist noch einmal theologisch präformiert, bildet also nicht den großen Rahmen zeitdiagnostischer Möglichkeiten ab, sondern wird fokussiert durch die leitende Fragestellung, inwiefern die pastorale Praxis der Kirche mit ihrer inhaltlichen Perspektive hin auf das Reich Gottes einerseits mit der Wirklichkeit der Menschen heute vermittelbar ist; wie aber andererseits das Handeln der Kirche diese Frage selbst unterläuft. Die in der Studie vorgenommenen soziologischen Referenzen bilden daher auch nicht all das ab, was in der Wissenschaftsgemeinde publiziert wurde. Die Arbeit greift vielmehr nur auf solche zurück, die zum einen innerhalb der Theologie über eine relativ große Rezeption verfügen und die zum anderen auch in den Gesamtkontext des zeitdiagnostischen Ansatzes der vorliegenden Studie selbst integrierbar sind. Dass es sich dabei um eine Auswahl handelt, die selbst noch einmal kritisch befragt werden kann, ist evident, aber unabdingbar aufgrund der Fülle der Untersuchungen einerseits und des begrenzten Platzes innerhalb einer Arbeit, die solche Fragen nicht zentral behandeln will, andererseits. Es werden auch Untersuchungen berücksichtigt, die auf empirischen Daten fußen. Eine empirische Erhebung wird aber nicht durchgeführt. Vielmehr werden diese Untersuchungen wiederum einer theologischen Fragestellung unterworfen. Leitend ist dabei die von Paul Ricœur stammende, aber auf Karl Marx, Friedrich Nietzsche und Sigmund Freud zurückgehende „Hermeneutik des Verdachts“ 13, die in der Theologie ja an anderer Stelle schon als hilfreich sich erwiesen hat, wo darunter ein ideologiekritisches Verfahren verstanden wird, das jeden Text und jede Überlieferung mit dem Verdacht belegt, die herrschenden Strukturen zu legitimieren. 14
Weiterhin ist es notwendig, die gesellschaftlichen Makrostrukturen in den Blick zu nehmen, in denen sich heute eine neue Religionsfreudigkeit herausgebildet hat, die ohne jegliche Gotteshoffnung sich artikuliert, oder einen neuen Gott an die Stelle des biblischen setzt (Kap. 4). Bei all dem müssen natürlich zwei Hinweise berücksichtigt werden, einerseits der von Rolf Zerfaß, die Wahrnehmung der Vielschichtigkeit und Vielgesichtigkeit kirchlicher Praxis, „auf der Ebene der einzelnen Biographie, der Gruppen und Gemeinden sowie der Kirche(n) in ihren kulturellen und gesellschaftlichen Kontexten auf Zukunft hin – d.h. im Verheißungshorizont der Herrschaft Gottes“ 15zu bedenken, und der Hinweis von Ottmar Fuchs auf die Kontextbezogenheit der praktisch-theologischen Wahrnehmung, in der es nicht „die Praxis des Menschen, sondern nur die Praxis verschiedener Menschen in verschiedenen Herkunfts- und Lebenszusammenhängen“ 16gebe.
Читать дальше