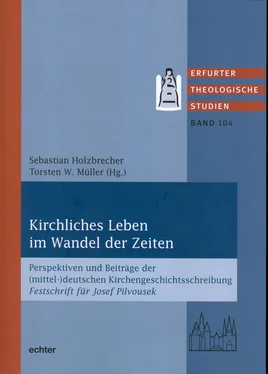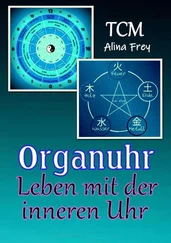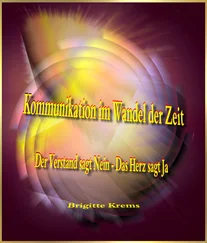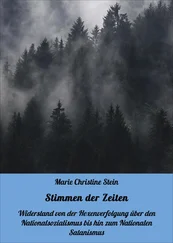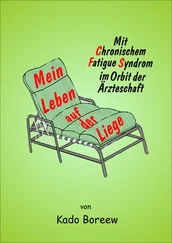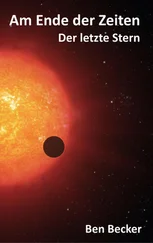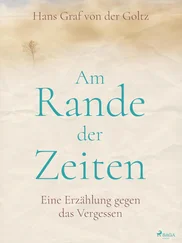Das hohe Priesterideal, das Kirchenrecht, Theologie und Katechismen propagierten, ging mit einem entsprechenden Selbstverständnis der Priester einher, wie Renate Dürr in einer Studie, die Predigten des 17. und 18. Jahrhunderts auswertet, nachgewiesen hat. Immer wieder wurde die Äußerung Franz von Assisis zitiert, er würde „wenn ihm ein Heiliger aus dem Paradies und ein Priester begegnen sollte, zuvor den Priester und dann erst den Heiligen ehren“. 31 Und noch häufiger Bernhardin von Siena, der dem Priester eine höhere Würde als der Jungfrau Maria zusprach. „Denn während Maria acht Worte gebraucht habe, um Christus in ihr zu einem Menschen zu wandeln, brauche der Priester nur die fünf Worte: Hoc est enim corpus meum. … Und schließlich habe Maria die Wandlung nur einmal vollzogen, der Priester aber könne, sooft er wolle, und wenn er die Wandlung hundert Mal am Tag vollzöge, Christus vom Himmel herunterholen.“ 32 Gerne zitierten die Priester auch Clemens Romanus mit der Feststellung, „Was ist ein Priester? ein irrdischer Gott“ 33 . Als „Glückseligkeit“ des Priesters wird dargestellt, wenn er Christus „als einen Gefangenen“ in Händen hält, und über dem Altar den Leib Christi wandelt und opfert: „Oh Heiligkeit der Hände! der mich erschaffen / hat mir gegeben zu erschaffen sich / und der mich erschaffen ohne mich / wird erschaffen durch mich.“ 34
Im 19. Jahrhundert, nach den Herausforderungen durch Aufklärung und Revolution, erfuhr dieses hohe Prestige des Klerikers eine erneute Steigerung. 35 Immer stärker sah man in ihm den in persona Christi Handelnden. „Weil er – und nicht nur der Papst – Stellvertreter Christi qua Amt ist, hat ein Priester Amtscharisma.“ 36 Er korrespondierte, wie es Olaf Blaschke formuliert, mit den heiligen Mächten über Raum und Zeit hinweg: „Im Priester realisierten und objektivierten sich die göttlichen Kräfte, mit denen er besonders im Ritual eine Identität herstellte, die den Laien verschlossen blieb.“ 37
Ferner wurde immer stärker das „Paradigma des Dualismus“ 38 propagiert, die Einteilung der Welt in Gut und Böse, die auch die Laien und den Klerus betraf: „Es gab eine scharfe Trennung zwischen den vermeintlich weltzugewandten ‚Fleischlichen‘ und den weltabgewandten ‚Geistlichen‘.“ 39 Ein Laienpriestertum könne – so das Wetzer-Weltesche Kirchenlexikon von 1884 – „im Ernste von Niemandem behauptet werden“, denn „dogmatisch betrachtet ist die priesterliche Würde die denkbar höchste, eine durchaus eigenartige und wunderbare. Der Priester müsste bei abstracter Betrachtung seiner Würde nothwendig stolz werden.“ Die Laien sind ihm aufgrund seiner priesterlichen Würde „zum Gehorsam verpflichtet“. 40
Dieses übersteigerte Priesterideal ist, mit Blick auf Deutschland, zumindest für die Epoche zwischen Säkularisation und Postmoderne festzustellen, die nicht selten als „Zweites konfessionelles Zeitalter“ 41 charakterisiert wird. Hatte es Entsprechungen in anderen Religionsgemeinschaften, Religionen und Zeiten? Zu untersuchen wäre auch, inwieweit an religiöse Eliten Erwartungen herangetragen wurden, die politischen, sozialen oder wirtschaftlichen Interessen entsprachen, und wie diese sich auf das Selbstbild der religiösen Funktionsträger auswirkten. Denn die Funktionsträger hatten ein breites Spektrum an Aufgaben zu erfüllen, die sich nur zum Teil den kirchlichen Grundvollzügen Zeugnis, Liturgie und Diakonie zuordnen ließen und auch aus völlig anderen Bereichen stammten. Sie konnten sich beispielsweise primär als Seelsorger sehen, aber auch als Standespersonen in staatlichem oder kirchlichem Auftrag. Entscheidend für das Bild religiöser Eliten ist schließlich dessen Verkörperung, die symbolische Darstellung und Inszenierung von Ämtern, Funktionen und Charisma. 42 Hier könnte sich auch der Habitus-Begriff als heuristisch wertvoll erweisen.
Grundlegend für die Erforschung dieser Fragen ist die Verbesserung der Zugänglichkeit der Quellen über sprachliche Barrieren hinweg. Aus „Ego-Dokumenten“ des Klerus wie Autobiografien und Briefe, aber auch aus Pfarrchroniken, Predigt- und Katechesebüchern ließe sich die Frage beantworten, woraus die religiösen Eliten eigentlich ihre Identität gewannen und wie ihre sozialen Bezugsgruppen aussahen. Mit Blick auf den katholischen Klerus wäre es beispielsweise interessant zu wissen, welche Bedeutung der Priesterweihe und dem damit übertragenen Charakter indelebilis oder der täglichen Zelebration der Messe zukam. Zu berücksichtigen sind aber auch ganz andere Identitätskategorien wie Familie, Geschlecht, Generation und soziale Schicht.
Soziale Herkunft und Rekrutierung
Im Hinblick auf die Rekrutierung und Sozialisation der religiösen Eliten ist ein grundsätzlicher Unterschied augenfällig: Während beispielsweise nicht wenige evangelische Pfarrer selbst aus einem evangelischen Pfarrhaus stammen, ist dieser Weg der Nachfolge dem katholischen Klerus wegen des Zölibats versperrt. Katholische Priester müssen immer wieder aus dem Laienstand rekrutiert werden – so sind die strikten normativen Vorgaben. Damit verfügt der katholische Klerus nur über mittelbaren Einfluss auf die wichtigste Sozialisationsinstanz, das Elternhaus 43 – zumindest dem Anspruch nach.
Tatsächlich gab es in der Frühen Neuzeit doch so etwas wie katholische Pfarrersdynastien: Nicht selten folgte der illegitime Sohn eines katholischen Pfarrers und dessen Haushälterin seinem Vater in derselben Pfarrei nach, und das oft über mehrere Generationen hinweg. Möglicherweise war die Durchsetzung und strikte Einhaltung des Zölibats in der katholischen Kirche doch erst eine Sache des 19. Jahrhunderts. Das Bemühen ist aber auch schon in der Frühen Neuzeit nachweisbar, unter anderem in den zahlreichen Reformdekreten zum Thema Pfarrhaushälterin. So heißt es, um nur ein Beispiel zu nennen, in einer 1559 im Erzbistum Trier erlassenen Vorschrift: Als Pfarrhaushälterin untragbar seien „junge, hübsche, aufreizende (lasziva), herausgeputzte, herrische, faule, schamlose und vorwitzige“ Frauenspersonen; zugelassen dagegen „betagte, füllige, sittsame, besonnene, keusche, ungepflegte (incultura), arbeitsame und ernsthafte“ Frauen. Am besten nehme man eine Person, die „gemäß öffentlichem Zeugnis keusch ist, eine Witwe, oder eine ältere Jungfrau“. 44
Vergleichend ist danach zu fragen, welche Folgen es hatte, wenn die Elite einiger christlicher Kirchen ihre Ämter nicht an direkte leibliche Nachkommen vererben konnte. Welche Bedeutung kommt in diesem Kontext größeren Familiennetzwerken und dem Nepotismus zu? Auf welche Eigenschaften achtete man bei der Rekrutierung? Wie offen war sie für Leistungsträger, wie sehr war sie an professionellen Kriterien orientiert? Inwieweit sorgte sie für soziale Mobilität? Welche Barrieren gab es in Abhängigkeit vom Geschlecht und Familienstand, von regionaler und nationaler Herkunft, von Stand, sozialer Schicht und Bildungsniveau? Waren verheiratete Funktionsträger ebenso straff in Hierarchien einzubinden wie unverheiratete? Was motivierte den Nachwuchs, eine religiöse Laufbahn einzuschlagen? Für die katholische Kirche bedeutete es eine einschneidende Veränderung, dass das Bischofsamt im 19. Jahrhundert zunehmend auch Nichtadeligen offenstand. 45 Wo liegen die Konstanten, was unterlag dem grundsätzlichen Wandel? Gibt es einen Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft des Inhabers eines religiösen Amtes und seiner theologischen und politischen Einstellung, insbesondere seiner Beurteilung der Moderne?
Irmtraud Götz von Olenhusen stellte in ihrer Studie „Klerus und abweichendes Verhalten“ für das Erzbistum Freiburg die These auf: Je einfacher und ländlicher die Herkunft der Priesteramtskandidaten, desto intransigenter, ultramontaner, fundamentalistischer war ihre Einstellung. Umgekehrt stehe eine städtische Herkunft eher für Aufgeschlossenheit und „Liberalität“. Eine solche Auffassung zeigt sich beispielsweise in einer Äußerung des Großherzogs Friedrich I. von Baden aus dem Jahr 1886 beim Besuch des Freiburger Priesterseminars: „Von Interesse war mir, die sämtlichen Seminaristen kennenzulernen. Unter den 64 jungen Leuten befindet sich nur einer, der gebildeten Kreisen entstammt … Alle andern stammen aus den niedersten Kreisen der Bevölkerung, Bauern, Tagelöhner, Kleingewerbe, niedere Bedienstete, Volksschullehrer. Alle kurzsichtig, körperlich schwach entwickelt, ohne jedwede Haltung und dementsprechend schüchtern und ängstlich. Ich hatte den Eindruck, mit völlig willenlosen Menschen zu verkehren. Nur wenn von der Universität die Rede war, klang der Ton lebhafter. Die Lehrer machen einen ähnlichen Eindruck.“ 46 Im selben Brief äußerte der Großherzog sich andererseits empört über die „geradezu revolutionäre Hetzarbeit“ der katholischen Geistlichen. Olenhusen dazu: „Der katholische Klerus war zum natürlichen Verbündeten der unterbürgerlichen, ländlichen Schichten geworden. Das Gegenteil dessen, was die Liberalen beabsichtigt hatten, war eingetreten. Das katholische Milieu unter klerikaler Führung hatte sich zu einer politisch bedeutsamen – antiliberal und antikapitalistisch orientierten – Kraft entwickelt.“ 47 Es wäre spannend zu prüfen, ob diese These auch für andere Zeiten und andere Regionen Europas Gültigkeit besitzt. Die Quellenbasis könnten im katholischen Bereich die Priesterakten in den europäischen Diözesanarchiven bilden, wobei es zunächst um eine umfassende (auch) statistische Untersuchung zum Thema soziale Herkunft und „wissenskulturelle“ Einstellung des Klerus gehen muss. Prosopografische Datenbanken und kollektive Biografien 48 könnten hier methodisch zielführende Ansätze sein. Allerdings ist vorab zu klären, ob beispielsweise die exzellente Priesterkartei des Bistums Münster, die fünfhundert Jahre umspannt, eine Ausnahme darstellt oder religiöse Eliten auch für andere Regionen und Glaubensgemeinschaften ähnlich gut dokumentiert sind.
Читать дальше