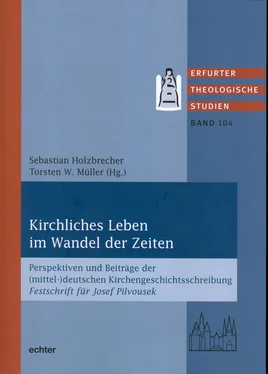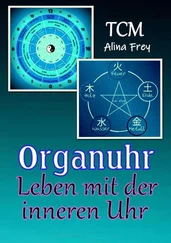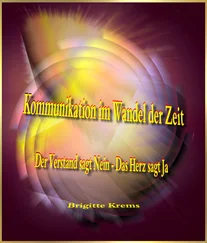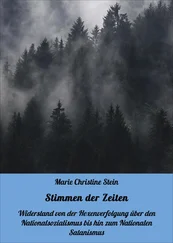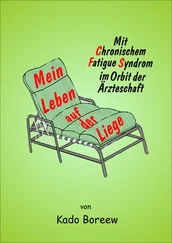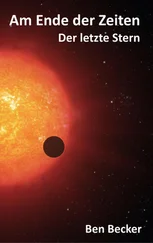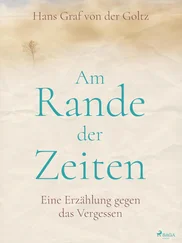Das Projekt „Geschichte der Universität Leipzig 1409–2009“. Aufgabenstellung, Probleme, Erfahrungen
Klemens Richter
Liebfrauengemeinde Leipzig-Lindenau. Eine Arbeiterpfarrei Mitteldeutschlands als ein Zentrum der liturgischen Erneuerung
Klaus-Bernward Springer
Was war und was ist ostdeutscher Katholizismus?
Anhang
Publikationen von Prof. Dr. Josef Pilvousek
Von Josef Pilvousek betreute Habilitationen und Dissertationen
Autorenverzeichnis
Reihenverzeichnis

Grußwort von Bischof em. Joachim Wanke
Es freut mich sehr, auf diesem Wege den durch diese Festschrift geehrten langjährigen Erfurter Kirchenhistoriker Professor Dr. Josef Pilvousek grüßen zu können.
Damit verbinde ich meinen herzlichen Dank für die Lehr- und Forschungstätigkeit von Prof. Pilvousek in den letzten Jahrzehnten. Seine Biografie prädestinierte ihn nahezu zu dem Forschungsschwerpunkt, dem er sich, neben den anderen Aufgaben und Verpflichtungen, die ein kirchenhistorischer Lehrstuhl mit sich bringt, intensiv widmet: Die Wanderungsbewegung der Bevölkerung speziell in der letzten Kriegsund Nachkriegszeit und deren Auswirkungen auf das Leben der Kirchen in Mitteldeutschland.
Selbst zwar schon kurz nach Kriegsende im Eichsfeld geboren, empfand er doch von seiner sudetendeutschen Familiengeschichte her geprägt, was ein Vertriebenenschicksal bedeutet. Prof. Pilvousek begegnete als Seelsorger vielen katholischen Christen, die, aus dem Osten stammend, sich in Thüringen eine neue, nicht zuletzt auch kirchliche Heimat suchen mussten. Dieser Dimension kirchlicher Aufbauarbeit in einem überwiegend nichtkatholischen Umfeld galt das Interesse und auch der Lebenseinsatz des Geehrten.
In dem von ihm aufgebauten und von seinen Schülern mit Leben erfüllten „Seminar für Zeitgeschichte“, das von den Bischöfen der Region Ost bis heute aus guten Gründen unterstützt wird, spiegelt sich eine für die mitteldeutsche Region wichtige Periode kirchlich-katholischer Geschichte. Viele wissenschaftliche Arbeiten sind aus diesem Seminar – heute „Forschungsstelle für kirchliche Zeitgeschichte Erfurt“ – schon erwachsen, für deren Anregung und ermutigende Begleitung Prof. Pilvousek, aber natürlich auch den Autoren, sehr zu danken ist.
Und schließlich beziehe ich auch in diesen Dank alles mit ein, was Josef Pilvousek über seinen Dienst in theologischer Lehre und Forschung hinaus in die Seelsorge und Bildungsarbeit unseres Bistums und des mitteldeutschen Raumes eingebracht hat. Seine tiefe Anteilnahme am Wohl und Gedeihen unserer Kirche in dieser Region, die durch die zweifachen Umbrüche 1945 und 1989/90 herausgefordert und geprägt wurde, hält bis heute an. Für den Professor und Priester blieb es nicht beim Forschen. Er hat im „Weinberg des Herrn“ selbst mit Hand angelegt und tatkräftig mitgestaltet. Und nicht zuletzt werden die Gemeindemitglieder der Pfarrei Erfurt-Hochheim und vor allem die dazu gehörende Gemeinde Neudietendorf sicher dankbar sein, den emeritierten Professor auch weiterhin als Helfer in der Gemeindeseelsorge noch lange in ihrer Mitte zu haben.
Gott schenke dem scheidenden Professor und Lehrstuhlinhaber für Kirchengeschichte an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt noch viele gesegnete Jahre!
Erfurt, im März 2013
+ Joachim Wanke
Bischof em.

Geleitwort von Dekan Prof. Dr. Michael Gabel
Die Verabschiedung eines geschätzten Kollegen in den wohlverdienten Ruhestand ist für eine Fakultät mit Stolz und Wehmut zugleich verbunden. In herausragender Weise gilt dies für den Kollegen Professor Dr. Josef Pilvousek, den Inhaber des Lehrstuhls für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Professor Pilvousek ist nicht nur ein hervorragender Kenner des Spätmittelalters und der Reformationsgeschichte, sondern zugleich ausgewiesener Experte der kirchlichen Zeitgeschichte in Mittel-und Ostdeutschland. Man geht durchaus nicht fehl, wenn man in ihm das personifizierte Geschichtsbewusstsein des ehemaligen „Philosophisch-Theologischen Studiums“ und der heutigen staatlichen theologischen Fakultät an der Universität Erfurt sieht.
Die Wurzeln für diese kenntnisreiche Vertrautheit mit der kirchlichen Zeitgeschichte liegen bereits in seiner Herkunft begründet. 1948 in Thalwenden, einem Dorf im katholischen Eichsfeld, geboren, weist die Herkunft seiner Familie jedoch auf das Sudetenland als Heimat zurück, die man nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs verlassen musste. Der Familiengeschichte nach durch Flucht und Vertreibung geprägt und der eigenen Lebensgeschichte nach durch das Leben im katholischen Eichsfeld bestimmt, haben in der Person von Professor Pilvousek die beiden sozialen Erscheinungsformen des Katholizismus in Mittel-und Ostdeutschland eine innere Verbindung gefunden. Die eigene Lebenserfahrung schärfte sein historisches Bewusstsein für die einzigartige Minderheitensituation des ostdeutschen Katholizismus, der in seiner Mehrheit in weit verstreuten kleinen Diasporagemeinden und nur in wenigen größeren katholischen Enklaven lebt.
Nach der Schulbildung im Eichsfeld hat er in Halle die altsprachliche Zurüstung für das Theologiestudium empfangen, um 1970-1975 am Philosophisch-Theologischen Studium Erfurt sein Theologiestudium zu absolvieren. 1977 empfing er die Priesterweihe in Erfurt. Nach wenigen Jahren in der seelsorgerischen Praxis wurde er 1980 zum Assistenten am Philosophisch-Theologischen Studium Erfurt berufen. Die Forschungen zum Lizenziat (1983) und Doktorat der Theologie schloss er 1985 mit der Dissertation „Die Prälaten des Kollegiatsstifts St. Marien in Erfurt von 1400-1555“ ab. Mit diesen Studien zum Spätmittelalter und zur Zeit der Reformation gewann Josef Pilvousek sein tiefes Verständnis der komplexen Zusammenhänge, die kirchliches wie weltliches Leben im ausgehenden Mittelalter prägten und letztlich in Martin Luther zur Reformation führten.
Seit 1988 mit der Verwaltung des Lehrstuhls für Kirchengeschichte beauftragt, wurde Josef Pilvousek im September 1994 zum Professor für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit berufen. Kollege Pilvousek konnte als theologischer Lehrer aus der Mitte seiner Forschungen heraus den Studierenden ein ausgewogenes Verständnis der Reformation und der sich daraus ergebenden Konfessionalisierung des christlichen Glaubens vermitteln. Seine Studien zum Spätmittelalter und zur Reformationszeit schärften aber auch den Blick für die kirchliche Zeitgeschichte in Mittel- und Ostdeutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, die ein konfessionelles Miteinander unter den Bedingungen einer extremen Diasporasituation mit sich brachte. So lautet die entscheidende Frage für die Forschungen von Josef Pilvousek bis heute, wie sich in dieser Zeit auf dem Gebiet der ehemaligen DDR unter den Bedingungen einer vorwiegend protestantischen Tradition und unter der Vorherrschaft einer kommunistisch-atheistischen Ideologie katholisches Leben entwickeln konnte. Literarischen Niederschlag haben seine Forschungen in zahlreichen Artikeln gefunden, in denen Josef Pilvousek den Verwerfungen des Krieges und der Nachkriegszeit nachgegangen ist, um unter diesen Bedingungen das kirchliche Handeln herauszuarbeiten, dass trotz des Migrationsschicksals der Katholiken dennoch zu stabilen Gemeinden und Jurisdiktionsbezirken führte, aus denen die heutigen Bistümer Mittel- und Ostdeutschlands hervorgegangen sind. Seine Forschungsergebnisse gewähren tiefen Einblick in die besonderen Umstände, unter denen die katholische Kirche in der DDR ihre Identität bewahren musste. Zentrale Bedeutung kommt dabei sowohl dem Aufsatz „Die Katholische Kirche und die Anfänge einer historischen Aufarbeitung 1990-1996“ aus dem Jahr 2009 wie auch der zweibändigen Quellenedition „Kirchliches Leben im totalitären Staat. Seelsorge in der SBZ/DDR 1945 bis 1976 / 1977 bis 1989“ von 1994 sowie 1998 zu. Ihre besondere Charakteristik haben diese Entwicklungen von den kirchlichen Akteuren, vorzugsweise den Bischöfen, in dieser Zeit empfangen. So war es nur folgerichtig, dass Josef Pilvousek in dem von Erwin Gatz herausgegebenen Sammelband „Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1945-2002“ (2002) die Biografien der ostdeutschen Bischöfe angefangen von Konrad Graf von Preysing bis hin zu Joachim Reinelt und Joachim Wanke vorgestellt hat. Das beachtliche Ergebnis dieser Studien und Arbeiten ist der innere Einblick in einen über sechs Jahrzehnte hin gewachsenen, trotz zahlreicher unterschiedlicher Bedingungen und innerer Spannungen doch weit gehend einheitlichen pastoralen Raum der katholischen Kirche in Ostdeutschland.
Читать дальше