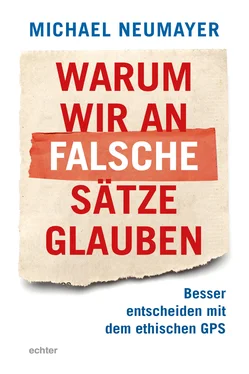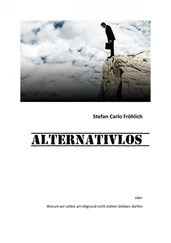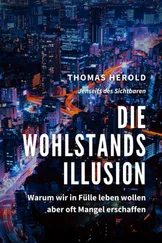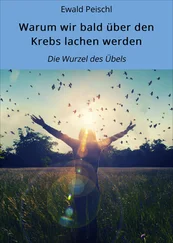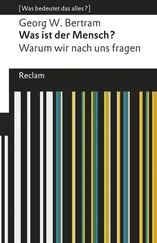Ein anderes negatives Beispiel unternehmerischer Hybris zeigt sich in der Gestaltung von Kundenbeziehungen. Denn Kunden fühlen sich zunehmend als unmündige Objekte des Marketings – und nicht mehr als Personen in einem personenorientieren Kommunikationsgeschehen. Als Folge verschließen sie sich – trotz des Einsatzes effektiver Kommunikationsmittel – immer stärker gegen Marketing- und Akquisitions-Maßnahmen. Denn nicht der eigentliche Mensch und seine eigentlichen Bedürfnisse stehen mehr im Vordergrund, sondern seine Verzweckung, seine objektive wirtschaftliche Nützlichkeit. Ähnliches gilt für Mitarbeiter in Unternehmen. Sie erfahren sich als austauschbare Objekte des Betriebes. Schon die Verwendung von Objektsprache kann auf eine systematische Fehlhaltung hinweisen. Kunden werden dabei typischerweise als „Verbraucher“, „Konsumenten“, „Benutzer“, „Targets“ usf. bezeichnet. Mitarbeiter von Unternehmen werden mit Chips ausgestattet und ihre Arbeit oft ohne ihr Wissen überwacht und von Maschinen protokolliert. Das maschinenunterstützte ökonomische System verfügt über Kunden und Mitarbeiter als „Objekte“ und übt Macht über sie aus. Dabei passt sich das System nicht den Bedürfnissen der Menschen an, sondern den Effizienzanforderungen der Maschinen. 16Dennoch bleiben viele Menschen auf diese Wirtschaft und auf solche Arbeitsverhältnisse angewiesen – und das führt nachvollziehbar zu großer Frustration und Ängsten, die leider auch eine der Quellen politischer Radikalisierung sind.
5. Prinzipienbasierte Unternehmenskultur
5.1 Compliance als Basis der Risiko-Kultur
Beim Begriff Ethik und ethische Unternehmenskultur denken unsere Kunden beim Erstgespräch erfahrungsgemäß zunächst meist an einschränkende moralische Verhaltenskodizes, ethische Vorschriften, Regelwerke o. Ä. Schlimmer noch: Ohne es jemals tatsächlich ausgesprochen zu haben, halten sie uns manchmal vermutlich für verkappte Moralapostel. Nichts liegt uns ferner, denn solche ethischen Systeme und Vorschriften-Gestelle würden die unternehmerische Freiheit – die ohnehin schon durch unzählige Vorschriften und Regulierungen begrenzt wird – nur noch weiter belasten. Sie sehen in der Unternehmensethik eine Form von „moralischer Compliance“ mit hocherhobenem Zeigefinger. Aber genau das verstehen wir unter unternehmerischer Ethik-Kultur oder Risiko-Kultur gerade nicht .
Was aber ist der Zusammenhang zwischen Compliance und einer angemessenen Risiko-Kultur oder ethischen Unternehmenskultur? Im betriebswirtschaftlichen Kontext meint Compliance Regelkonformität , d. h. die firmenweite Einhaltung gesetzlich vorgeschriebener Bestimmungen, Richtlinien und Normen oder auch die Beachtung freiwillig gewählter Ethik-Kodizes. Für Unternehmen gibt es zahlreiche rechtlich verbindliche und vernünftig begründete Richtlinien, Prinzipien, Normen oder Gesetze zu beachten, die im Rahmen rechtsstaatlicher Vorgänge ausgearbeitet, erlassen oder empfohlen wurden. Verbände, Aufsichtsbehörden, Länder, Bund, EU-Kommissionen usf. entwickeln, erlassen oder empfehlen solche Regularien. Für Banken beschreibt die BaFin die Compliance-Funktion ausführlich im MaRisk-Modul „Compliance-Funktion“. Diese Compliance-Prinzipien sind die Grundlage einer bankweiten „Compliance-Kultur“, die auf Basis dieser aufsichtsrechtlichen Richtlinien und der vernunftethischen Prinzipien selbstdefinierter Ethik-Kodizes zunächst zwischen richtig und falsch zu unterscheiden hilft. Insofern ist die Compliance-Kultur die Basis oder erste Ebene der angemessenen Risiko-Kultur. Doch die Entwicklung einer angemessenen Risiko-Kultur erfordert mehr als nur die Vermeidung des unzulässigen, d. h. schlechten Handelns, wie wir in Zusammenhang mit der Hybris der ethosfreien Räume erkannt haben. Sie wird vielmehr sichtbar in einer Entscheidungskompetenz, die vom Guten zum Besseren führen kann.
5.2 Regeln oder Prinzipien?
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer regelbasierten und einer prinzipienorientierten Unternehmenskultur? Die BaFin stellt im Konsultationsentwurf zur MaRisk-Novelle fest, dass die MaRisk prinzipienorientiert aufgebaut sind . Was ist aber der Unterschied bzw. Vorteil gegenüber „rein“ regelbasierten Anforderungen? Im rechtswissenschaftlichen Zusammenhang – und der ist für die MaRisk und die Risiko-Kultur entscheidend – sind Prinzipien Grundsätze oder Leitlinien, die möglichst umfassend realisiert werden sollen (englisch: principles, guidelines). Prinzipien sind verbindliche Empfehlungen, deren Umsetzung und Erfüllung in der Praxis oft nur graduell gelingt. 17Verbindlich ist aber, dass man sich nachweislich bemüht, dem Prinzip so gut zu entsprechen, wie es situationsbedingt möglich ist. Sprachlich sind Prinzipien an Formulierungen wie: „Empfehlenswert ist es …“ oder „Bemühen Sie sich …“, „Streben Sie danach, dass …“ usf. erkennbar. Regeln hingegen sind Vorschriften und Normen, die eingehalten werden müssen (englisch: rules and regulations). Die Erfüllung der Regel kennt nur ein Ja oder Nein. Denken Sie beispielsweise an Verkehrsregeln oder an die Abseitsregel des Fußballspiels oder die Regeln einer Poker-Partie. Regeln haben keinen „Empfehlungscharakter“. Hier heißt es typischerweise: „Du musst …“, „Du darfst nicht …“, „Verboten ist es …“. Man erfüllt sie – und tut das Richtige, oder man erfüllt sie nicht – und verhält sich falsch. So wird verständlicher, warum die Anforderungen an die angemessene Risiko-Kultur als Prinzipien und nicht als strikte Regeln formuliert wurden. Normen würden nicht den Spielraum ermöglichen, der nötig ist, damit die inneren Einstellungen und Haltungen kultiviert werden können. Kulturentwicklung kann nicht einfach „verordnet“ und bloß „reguliert“ werden. Kultur muss wachsen können.
5.3 Die Schachmetapher
Der Unterschied zwischen Prinzip und Regel lässt auch anschaulich anhand des Schachspielens erklären. Die Spielregeln des Schachs bestimmen beispielsweise die konkreten Zugvorschriften der Figuren. Andere Regeln betreffen Details wie die Schwarz-Weiß-Struktur der 8 × 8 Felder des Spielfeldes, die Eröffnungsregel „Weiß beginnt“ oder – im weiteren Sinne – den Ablauf eines Schachturniers. Doch wie kann ich in einer konkreten Spielsituation den besseren Zug für mich herausfinden? Die Schachregeln legen zwar eindeutig alle Zug möglichkeiten fest, liefern aber keinen weiteren Hinweis darauf, wie ich spielen soll. Dann ist die entscheidende Frage: Welcher ist der bessere Zug? Dass ich meinen Turm nicht diagonal ziehen darf, ist weniger relevant als die Frage, ob der Turm überhaupt zum Einsatz kommen soll und gegebenenfalls wie . Spielstrategien sind prinzipienbasiert . Ein Grundprinzip könnte lauten: Tausche keine Figur höherer Wertigkeit – beispielsweise die strategisch wichtige Dame – gegen eine Figur geringerer Wertigkeit – etwa gegen einen Bauern. Doch es ist nicht sinnvoll, dieses Prinzip in jeder Situation sozusagen vollautomatisch anzuwenden. Ein Damenopfer könnte notwendig sein, um im nächsten Zug das Schachmatt zu verhindern. Man spricht von einem „Qualitätsopfer“, wenn durch einen Tausch die strategische Stellung vorteilhafter wird. Manche Strategien spiegeln die Erfahrungen von häufig gespielten Partien wider – beispielsweise die bewährten Zugabfolgen der sogenannten „Eröffnungen“.
„Spielprinzipien“ sind also situationsabhängig zu interpretieren. Schachspieler lernen Partien auswendig und üben mit ihrem Trainer oder Computer. Durch eine komplexe Mischung aus kombinatorischem Vorausdenken , Spielerfahrung und Intuition wird es möglich, eine Stellung zu analysieren, um so schließlich (hoffentlich) den besseren Zug herausfinden zu können. Das Schachspiel hat nur wenige Regeln – und doch gleicht eine Partie kaum jemals exakt der anderen. Computer schlagen zwar inzwischen die weltbesten Spieler, aber die Frage, ob es eine optimale Gewinnstrategie gibt, ist in der Theorie noch unbeantwortet. 18Das ist ein interessantes Phänomen: Auch aus wenigen einfachen Regeln kann eine sehr komplexe Wirklichkeit entstehen.
Читать дальше