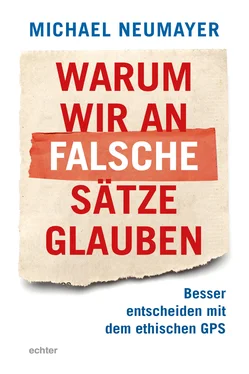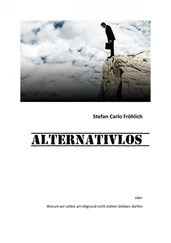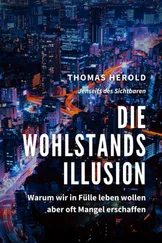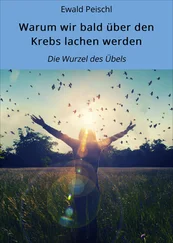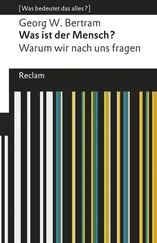4. Hybris und falsche Sätze
4.1 Die Hybris der „sakralisierten Markt-Mechanismen“
Wie schon in der Einleitung kurz erwähnt, werden die Spuren menschlicher Hybris nicht nur im technologischen Bereich, sondern auch in der Wirtschaft und der Unternehmenskultur sichtbar. Und oft wird diese unmenschliche Hybris in falschen Sätzen artikuliert. In Sätzen, die eine Wirtschaft rechtfertigen wollen, von der zum Beispiel Papst Franziskus in Evangelii Gaudium 9sogar wörtlich schreibt: „ Diese Wirtschaft tötet.“ Er wendet sich mit leidenschaftlichen Worten gegen eine Wirtschaft „der Ausschließung“ und der „sozialen Ungleichheit“ . Hier klingen gewiss auch konkrete Erfahrungen des Papstes mit der himmelschreienden Armut und sozialen Ungerechtigkeit in Lateinamerika an, jedoch ist die Ungerechtigkeit des Wirtschaftssystems ein wirklich globales Phänomen – Franziskus nennt es „Globalisierung der Gleichgültigkeit“ . Er bezweifelt den „unbewiesenen“ Ansatz der freien Marktwirtschaft und ihrer „ sakralisierten Mechanismen“ : die Behauptung, dass eine effiziente Marktwirtschaft schließlich doch irgendwie allen Menschen zugute kommen würde und „von sich aus eine größere Gleichheit und soziale Einbindung in der Welt hervorzurufen vermag “ 10. Das sind keine Zitate aus dem Hamburger Grundsatzprogramm der SPD, wo sie ebenso gut stehen könnten, sondern aus einer päpstlichen Enzyklika. Und diese Sätze sind wahr: Es ist mehr als fraglich, ob eine sich selbst organisierende freie Ökonomie, die sich nicht grundsätzlich an der Gleichwertigkeit und Gleichrangigkeit der Grundwerte von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität orientiert, für möglichst viele Menschen mehr menschenwürdige Arbeit, mehr Wohlstand und mehr Gerechtigkeit erbringen kann.
Anfang 2016 war das private Netto-Vermögen 11der 63 wohlhabendsten Menschen der Erde ebenso groß wie das aller anderen – also ca. 7400 000 000 – Menschen. Als Oxfam diese Zahlen veröffentlichte, wiesen einige Ökonomen darauf hin, dass diese doch kein generelles Anwachsen der globalen Ungleichheit belegen würden. Vielmehr würde die Schere zwischen Armen und Reichen unter bestimmten Aspekten sogar geringer, beispielsweise bei der medizinischen Versorgung oder im Bildungswesen. Auch würden langfristige Statistiken belegen, dass es etwa in Europa im 19. Jahrhundert prozentual gesehen mehr Arme gegeben habe als heute oder dass der Mittelstand in China wachsen würde. Wie auch immer: Die Oxfam-Zahlen sprechen deutlich für sich und belegen, dass die freien Marktkräfte jedenfalls nicht verhindern können, dass es grundsätzlich zu solch enormen Ungleichgewichten kommen kann. Und die vielen hunderte Millionen Armen und Ausgebeuteten erwarten von uns heute konkrete Hilfe und Maßnahmen – mit einer langfristigen statistischen Hoffnung lässt sich ihr aktuelles Elend wohl nicht beheben.
4.2 Die Hybris der ethosfreien Finanzräume
Die sogenannte Finanzkrise und diverse Unternehmensskandale haben sehr deutlich gemacht, wie unökonomisch unethisches Handeln sein kann. Kurzfristiger Geschäftserfolg wird nämlich langfristig durch den Reputationsverlust mehr als zunichtegemacht, wenn Tricksereien, Rechtsbrüche oder mangelndes Risikobewusstsein öffentlich werden. Der Vertrauensverlust schädigt die Geschäftsentwicklung oft nachhaltig und bringt mitunter ganze Branchen – zu Recht oder Unrecht – in Verruf (und insbesondere auch zur Freude der internationalen Konkurrenz). Hinzu kommen in Einzelfällen die manchmal enorm hohen Strafzahlungen oder außergerichtlich vereinbarten Summen zur Einstellung von Strafverfahren. Werden die Finanzunternehmen dann auch noch mit Steuergeldern „gerettet“, ist die öffentliche Empörung erfahrungsgemäß besonders groß. Der berechtigte Vorwurf lautet sehr verkürzt: Gewinne werden privatisiert, Verluste verstaatlicht .
Falsch ist dieser Satz nicht. Explizites ethisches Denken spielte insbesondere in der Finanzbranche bisher wohl nur eine untergeordnete Rolle. Inzwischen ist aber durch die vielen negativen Erfahrungen auch im EU-Raum die Einsicht gewachsen, dass weder Finanzmärkte noch Finanzinstitute ohne ethisches Bewusstsein sein dürfen. Denn eine zum Teil leider wirklich branchentypische unangemessene Entscheidungs-Unkultur machte es sich sehr einfach und unterscheidet nur sehr oberflächlich zwischen falschem und richtigem Handeln. Dieses falsche Denken gipfelt in dem falschen Satz: Richtig ist alles, was nicht gesetzlich verboten ist . Dadurch entsteht aber bei Entscheidungsträgern allzu leicht der Eindruck, dass es bezüglich der Handlungsoptionen jenseits der Grenzen des eindeutig Falschen gar keine ethisch relevanten Fragen mehr zu stellen oder zu beantworten gäbe. Als Investmentbanker fragte ich also bei den Kollegen der Compliance- und Rechtsabteilung nach : Ist diese Transaktion auch legal ? Im Zweifelsfall bezahlte ich noch ein externes Rechtsgutachten, um die Durchführbarkeit des Geschäfts rechtfertigen zu können. „ Mylord, is this legal?“ , fragt der Chef der Handelsföderation Nute Gunray seinen Auftraggeber Lord Sidious im Film Star Wars I. „ I’ll make it legal!“ , erhält er als Antwort. Nicht alle Investmentbanker sind potentielle Star-Wars-Bösewichte, aber wenn die rechtlichen Bedenken einmal zerstreut sind, werden darüber hinaus meist keine weiteren Fragen mehr gestellt. Just close the deal! Warum sollte ich auch ethische Bedenken haben? Wenn es nicht illegal ist, ist es ethisch irrelevant. Im Übrigen machen’s die Konkurrenten ja genauso und das Quartalsziel muss erreicht werden.
Der falsche Satz lautet also: Jenseits der Grenze des normativ Falschen liegt ein ethosfreier Raum 12Als Konsequenz dieser Haltung haben sich ethischer Anarchismus und persönliche Doppelmoral bei manchen Finanzinstituten und Marktteilnehmern hartnäckig etabliert. 13Die Hybris besteht also in einer sehr verkürzten Sichtweise unternehmerischer Ethik: in der Einstellung, dass alles möglich und machbar sei, was nicht den Vorschriften widerspreche. Die Hybris drückte sich auch aus in der besonders verhängnisvollen Selbsteinschätzung einer Investmentbank, die sich für „systemrelevant“ und daher „too big to fail“ hielt. Zumindest ein Teil dieser Annahme war offensichtlich falsch, denn die Bank ging pleite und das Finanzsystem überlebte dennoch – wenn auch nur durch entsprechende Interventionen und Hilfsmaßnahmen der Zentralbanken. Heftig diskutiert wird seither die Frage, ob oder mit welcher Effizienz sich der Finanzmarkt überhaupt selbst regulieren kann – resp. in welchem Ausmaß Aufsichtsbehörden, Zentralbanken und Politik steuernd und regulierend eingreifen sollen. Die Alternativen erscheinen ein bisschen wie die unglückliche Wahl zwischen Skylla und Charybdis 14: Entweder werden die Märkte durch die Vorschriften überreguliert und dadurch die Wirtschaft in ihrer Effizienz geschwächt, oder es besteht weiterhin die Gefahr, dass die sich selbst überlassenen Märkte doch wieder außer Kontrolle geraten.
Ist der freie Markt aber notwendigerweise unethisch bzw. ethosfrei? In der „alten“ Physik gab es das Prinzip des horror vacui – die „Furcht der Natur“ vor leeren Räumen. Hat der freie Markt vielleicht selbst auf irgendeine Weise Furcht davor, ethosleer – ethosfrei – zu sein? Denn die Erfahrung zeigt, dass vermeintliche ethische Irrelevanz unethisches und widersprüchliches Verhalten fördert, das die Marktentwicklung massiv beeinträchtigt. Ist es daher denkbar, dass der freie Markt sich selbst ethisch reguliert? Könnte die Emergenz einer Marktethik im Sinne einer neuen spontanen und unabhängigen Systemeigenschaft möglich sein? Eine solche Systemeigenschaft würde sich nicht mehr alleine in die Eigenschaften der Komponenten zerlegen lassen. Daher spiegelte eine solche Marktethik dann etwas anderes wider als den bloßen Durchschnitt oder die Summe der Ethik der (menschlichen) Marktteilnehmer. Vielmehr würde der freie Markt dann seine eigenen, vom Menschen unabhängigen, ethischen Prinzipien entwickeln. Ob wir diese verstehen könnten – und ob sie im Sinne der Menschen beispielsweise für mehr Verteilungsgerechtigkeit sorgen würden –, ist nochmals eine andere Frage. Wäre eine nicht-menschliche Markt-Intelligenz menschenfreundlich oder unmenschlich? Die aktuelle globale ökonomische Situation liefert jedenfalls keine positiven Hinweise auf eine Form selbst-emergierender menschenfreundlicher Marktethik. 15Bezüglich der Frage, wie frei oder unfrei der Markt denn sein solle, plädiere ich für einen Ansatz, der die Regularien fortwährend kritisch hinterfragt – so viele Regularien wie nötig und stets unter den Aspekten der Subsidiarität, Freiheit und Gerechtigkeit – und zugleich auf einer Selbststeuerung mündiger und verantwortungsbewusster Marktteilnehmer beruht, die sich in offenen Gesprächen über die Marktsteuerung austauschen. Diese Dialogbereitschaft wäre ganz im Sinne der angemessenen Risiko-Kultur für Finanzunternehmen, wie sie von der BaFin gefordert wird. Die persönliche Mündigkeit setzt aber beim Einzelnen die Wiederentdeckung des eigenen Gewissens und eine innere Haltung voraus, die nicht im radikalen Konstruktivismus oder Egoismus steckenbleibt, sondern bereit ist, die eigenen Grenzen zu beachten und überdies auch Phänomene der Transzendenz wahrzunehmen. Dann besteht wirklich eine Chance, die Hybris der ethosfreien Räume endgültig zu überwinden.
Читать дальше