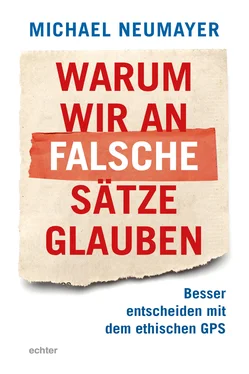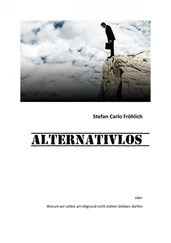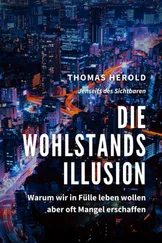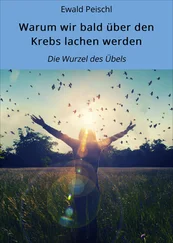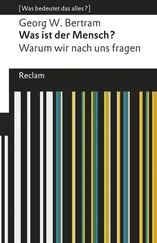1.
Entwicklung einer ethischen Unternehmenskultur
1. Theologie und Unternehmensberatung?
Was hat Theologie eigentlich mit Unternehmensberatung zu tun? Damit meine ich nicht etwa eine Frage nach der theologischen Begründung einer Unternehmensethik, sondern wie sich die persönliche Glaubenshaltung von christlichen Theologen in der Ethik-Beratung ausdrücken kann. Welche Bedeutung hat die theologische Sichtweise für meine Frau und mich in unserer unternehmerischen Ethik-Beratung 5?
Unsere Aufmerksamkeit gilt nicht zuallererst dem „abstrakten Unternehmen“ an sich, sondern all den Menschen, die dort arbeiten. Wir sehen immer den „ganzen Menschen“ als Person mit unantastbarer Würde und der freien Möglichkeit zur Mitgestaltung einer allen Menschen gemeinsamen Wirklichkeit, insbesondere der Arbeitswelt. Es ist eine menschenfreundliche und wohlwollende Anthropologie: Jede Person soll sich – individuell und doch ungetrennt von den Mitmenschen – entfalten können und dabei auch die Entwicklungsmöglichkeiten der Mitmenschen unterstützen und fördern unter den Aspekten Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Beständigkeit. Den Daseinserfahrungen von Angst, Scham und Schuld setzen wir die Erfahrungsmöglichkeiten von Lebensfülle, mitmenschlicher Nähe, Liebe und persönlicher Würde sowie die Möglichkeit zu Umkehr und Dankbarkeit und schließlich auch die Annahme der eigenen Unvollkommenheit gegenüber.
Als Theologen wecken wir das Bewusstsein für die Endlichkeit der Person – die aber stets unzureichende Rechtfertigung für Nihilismus oder Egozentriertheit bleibt. Als Ethics Counselors erinnern wir an die individuelle und gemeinsame Verantwortung gegenüber den Ressourcen der Biosphäre, die wir nicht nur für uns, sondern auch für künftige Generationen kultivieren müssen. Wir plädieren für die Notwendigkeit einer diskursbasierten Ethik zur gemeinsamen Entscheidungsfindung in Unternehmen zwecks Gestaltung einer nachhaltigen und gerechten Gesellschaft. Wir ermutigen durch Wort und Tat zur bleibenden Hoffnung auf eine bessere Zukunft auch angesichts ungerechter sozialer Strukturen: für die Hoffnung der Armen und Unterdrückten auf Befreiung. Wir haben Verständnis für die bleibende personale Unvollkommenheit und die Widersprüchlichkeiten des Daseins: Fehlentscheidungen können passieren. Umkehr und Neuanfang sind aber immer wieder möglich – und die „Vergebung“ von Fehlentscheidungen der anderen wird nachdrücklich empfohlen.
Als Theologen anerkennen wir die Pluralität, Eigengesetzlichkeit und Selbstorganisation und Evolution (Autopoiesis) der gesamten Wirklichkeit, die wir als Eine begreifen – die sich nicht eindeutig in Subjekt und Objekt oder Ich, Du und Es zerlegen lässt. Denn jede Person lebt vernetzt mit anderen in-der-Welt: Andere Weltanschauungen nennen diese Sichtweise alternativ „ganzheitlich“, „systemisch“ oder „integral“. Die eine Wirklichkeit aber entsteht durch das Wechselspiel mannigfaltiger Teilsysteme mit unterschiedlichen Prinzipien und Zielen und lässt sich nicht widerspruchsfrei in diese auflösen. Daher müssen persönliche ethische Navigationskompetenz und Diskursfähigkeit eingeübt werden, sodass eine Unterscheidung nicht nur zwischen richtig und falsch, sondern auch von gut und besser gelingen kann.
Als Theologen warnen wir aber auch vor den Gefahren der menschlichen Hybris (= Überheblichkeit und Selbstüberschätzung) und persönlichen Unaufrichtigkeit: Denn die je eigene Wirklichkeitskonstruktion ist nicht vollständig überschaubar und steuerbar; sie ist nicht wirklich die Wirklichkeit. Vollkommen alleine kann es die Einzelperson nicht schaffen, nur gemeinsam mit anderen wird eine bessere Wirklichkeit gelingen können. „Ich“ kann ohne „Du“ und „Wir“ weder wahrhaft „menschlich“ leben noch etwas Gutes gestalten. Das um sich selbst kreisende Ich, das egoistische Ego, verbleibt in einem Zustand der Selbstentfremdung und Unaufrichtigkeit (mauvaise foi, siehe Kapitel 2.6), der die eigene Daseinsentwicklung und Selbststeuerung wesentlich einschränkt, das Gewissen unterdrückt und die Dialogfähigkeit mit anderen behindert.
Ebenso klar sagen wir: Märkte, Unternehmen und Organisationen sind keine ethosfreien Räume. Ökonomie ohne ethisches Bewusstsein ist inhuman. Und gegenüber einem radikal-konstruktivistischen Ansatz betonen wir einen Daseinsvollzug, der sich seiner bleibenden Vorläufigkeit, Unvollständigkeit und „Modellhaftigkeit“ bewusst bleibt, aber dennoch auf Erlösung hoffen darf (aber eben nicht auf „Selbsterlösung“). Um der eigenen Selbstverzweckung und Unaufrichtigkeit vorzubeugen, muss der Lebensvollzug stets offen bleiben innerhalb eines Horizonts, der größer ist als alle Entwürfe und Wirklichkeitsdeutungen. Wir fordern zur Transzendenzbereitschaft auf und zum Deuten der „Zeichen der Zeit“. Auch bemühen wir uns um eine zeitgemäße und existenziell tragfähige Verhältnisbestimmung von Vernunft und Glaube: Die theologisch geschulte Vernunft bewahrt Glauben vor Aberglauben, Mythos und religiösem Fundamentalismus, und der vernünftige und aufgeklärte Glaube bewahrt die Vernunft vor der Hybris und den Gefahren des Positivismus, der radikalen Wirklichkeitskonstruktion, des wissenschaftlichen Reduktionismus, der technologischen Allmachtsphantasien („Technologie als Magie“) und der politischen Ideologien. Wahre Menschlichkeit bedarf einer Offenheit gegenüber dem Unerwarteten und Unbegreiflichen, das über mich selbst und die anderen, über „meine“ und „deine“ Wirklichkeit hinausgeht und alles umfängt und trägt. In ihrer Gesamtheit ermöglichen uns diese Haltungen in der unternehmerischen Ethik-Beratung, die Menschen beim Umdenken, Erkennen, Entscheiden und Handeln mit engagierter Gelassenheit zu begleiten.
2. Brücken bauen zwischen Wirtschaft und Ethik
Wie treffen ManagerInnen eigentlich unternehmerische Entscheidungen? Welchen Preis hat wirtschaftlicher Erfolg? Kann wirklich alles getan werden, was nicht verboten ist? Ist mit der Unterscheidung von richtig und falsch schon alles getan? Wie können Veränderungsprozesse in Unternehmen besser gelingen? Wie werden die fortschreitende Automatisierung und Digitalisierung die Arbeitsbedingungen der Menschen in Betrieben künftig verändern? Alle diese und ähnliche Fragen gipfeln in der Frage: Passen Ethik und Wirtschaft überhaupt zusammen?
Und es sind berechtigte Fragen, denn im Bewusstsein der Gesellschaft bekommt das Thema „Ethik in Unternehmen“ einen zunehmend großen Stellenwert. Gerade junge Menschen achten bei der Wahl des künftigen Arbeitgebers immer stärker auf das ethische Bewusstsein des Unternehmens. Und spätestens seit der globalen Finanzkrise forcieren Politiker auch auf internationaler Ebene ethische Maßnahmen. Beispielsweise empfehlen die G7-Finanzminister nachdrücklich die Entwicklung eines internationalen Code of Conduct für den Finanzsektor. In Deutschland plant die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), neue Vorgaben für die Entwicklung einer angemessenen ethischen Risiko-Kultur in die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) aufzunehmen. 6Dabei will sich die Aufsichtsbehörde an den überarbeiteten und im Juli 2015 veröffentlichten Grundsätzen des Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) 7orientieren. Daher stellt sich dringlicher denn je die Frage, wie Finanzunternehmen eine ethische Risiko-Kultur konkret entwickeln und fördern können – und wie BaFin und Deutsche Bundesbank diese Entwicklung künftig überprüfen und beaufsichtigen werden. Was sind mögliche konkrete Schritte, eine ethische Risiko-Kultur praktisch entwickeln zu können? Auf welche Indikatoren und Maßnahmen können die Supervisoren dabei zurückgreifen?
Mit solchen Fragen beschäftige ich mich gemeinsam mit meiner Frau in unserer Unternehmensberatung für ethische Unternehmenskulturentwicklung. So gesehen versuchen wir Brücken zu bauen zwischen Wirtschaft und Ethik. Aber: Kann das überhaupt gelingen? Oder gibt es vielleicht gar einen grundsätzlich nicht überbrückbaren Widerspruch zwischen wirtschaftlichen und ethischen Anforderungen? Lassen sich Gewinnstreben unter Konkurrenzdruck und ethische Prinzipien vereinbaren? Insofern man Ethik nur als einigermaßen starres Regelwerk und die Anwendung von unumstößlichen Prinzipien versteht, bleibt diese Frage vielleicht tatsächlich offen. Mit noch mehr Regulierung lässt sich wahrscheinlich keine ethischere Wirtschaft gestalten oder erzwingen. Zu viel Bürokratie bewirkt nur eine Abwehrhaltung und regt die Unternehmen dazu an, neue Umgehungsmöglichkeiten auszuprobieren. Daher sollte auch im Bereich der Unternehmensethik auf Subsidiarität geachtet werden. Ethisches Handeln und ethisches Bewusstsein lassen sich nicht ohne weiteres an Strukturen delegieren.
Читать дальше