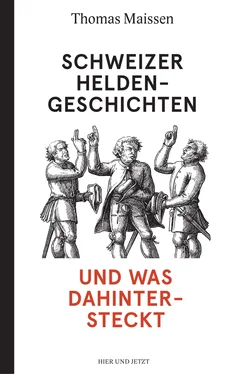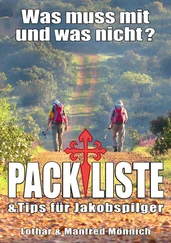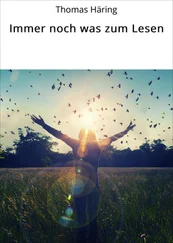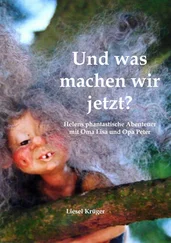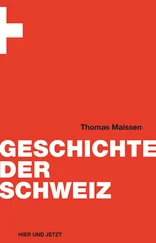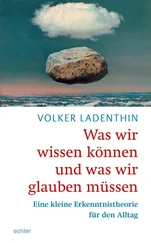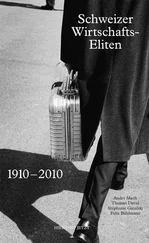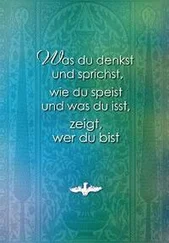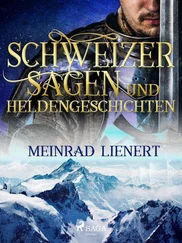Die Formulierungen zeigten bereits die Ausrichtung auch der Historikerzunft auf die Geistige Landesverteidigung der 1930er-Jahre. Die Diskrepanz zwischen dem Forschungsstand und den volkstümlichen Vorstellungen von der Schweizergeschichte war ihr bewusst. Doch der Appell an Freiheit und Opferbereitschaft hatte nichts Theoretisches, wenn ein völkisches Grossdeutschland im Norden drohte, von Süden der faschistische Irredentismus, der alle Italienischsprachigen in einem Staat vereinen wollte. Die Rede vom «Sonderfall» erfüllte nun eine existentielle Aufgabe. Sie legitimierte einen Staat, dessen Gemeinschaft nicht Blut und Sprache definierten, sondern Geschichte und, in Ernest Renans Worten, das alltägliche Plebiszit der Bürger. Die Einheit in der Vielfalt war in der Argumentation des federführenden Bundesrats Philipp Etter das Wichtigste: Viersprachigkeit, kulturelle Mittlerrolle, föderalistische Bundesstruktur, Gemeindeautonomie und Menschenwürde in einem christlichen Sinn. Gegenüber diesem Erbe der Alten Eidgenossenschaft traten die Errungenschaften von 1848 zurück: parlamentarische Demokratie, individuelle Freiheit und Gleichheit, eine liberale Wirtschaftsordnung. Definiert wurde der Sonderfall aussenpolitisch damit nicht nur in Abgrenzung zu den rechten und linken Totalitarismen, sondern auch zu den demokratisch legitimierten Volksfrontregimes in Frankreich und Spanien und den angloamerikanischen Modellen.
In gewisser Hinsicht hatte die schweizerische Historikerzunft Glück. Einer der Ihren, der Luzerner Katholik Karl Meyer, glaubte selbst an das, was er mit der Autorität eines Professors in Zürich verkündete: Die Befreiungserzählung einschliesslich der Tellensage war nicht Legende, sondern wahre Geschichte, und der einstige Widerstand genossenschaftlicher Kommunen gegen den fremden Adel gab das Modell für die Verteidigung des demokratischen Sonderfalls in der gegenwärtigen Bedrohung ab. 39Ähnlich erklärte der erwähnte Robert Durrer 1934 Winkelried gegen die «Pseudokritik des 19. Jahrh.» wieder zur historischen Figur. 40Dieser Rückschritt hinter Kopps hundert Jahre zuvor etablierte Quellenkritik provozierte klaren Widerspruch von fachkundigen Kollegen. Allein, Meyers Darlegungen fügten sich gut in die politische und gesellschaftliche Erwartungshaltung, dass die Vergangenheit Identität und Kontinuität stiften solle. 1941 beging der Bundesrat in diesem Geist zusammen mit General Guisan den 650. Geburtstag der Schweiz im kurz zuvor eingeweihten Schwyzer Bundesbriefarchiv, um in den ernsten Stunden die Verpflichtung gegenüber den Ahnen und ihr Vorbild zivil und religiös zu unterstreichen.
Die biografische Erfahrung der Kriegsjahre und vor allem des militärischen Aktivdiensts prägte die grosse Zahl von schweizergeschichtlichen Texten, die nach 1945 verfasst wurden und sich oft an ein weiteres Publikum wandten, so die Schriften von Georg Thürer, eines Schülers von Karl Meyer (Bundesspiegel. Werdegang und Verfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 1948). Es fällt auf, dass viele der Autoren nach oder neben ihrer historiografischen Tätigkeit politische Ämter übernahmen und sich somit in doppelter Hinsicht vaterländisch-gouvernemental betätigten. Gottfried Guggenbühl (Geschichte der Schweizer Eidgenossenschaft, 1947/48) war Zürcher Erziehungsrat; Peter Dürrenmatt (Schweizer Geschichte, 1957)vertrat den Kanton Basel-Stadt im Nationalrat; von den Autoren der wiederholt aufgelegten Illustrierten Geschichte der Schweiz (1958–1961) wirkte Karl Schib kurz als Kantonsrat und Sigmund Widmer als langjähriger Stadtpräsident von Zürich. Sie fügten sich in eine lange Reihe von Parlamentariern und Bundesräten ein, die Werke zur kantonalen oder nationalen Geschichte verfassten, wenn auch nicht unbedingt Gesamtdarstellungen. Bei den Bundesräten führte diese Tradition von Emil Freys erwähnten Kriegstaten der Schweizer (1904) über Markus Feldmann, den Koordinator der genannten Schweizer Kriegsgeschichte (1915–1923), bis Georges-André Chevallaz (Le défi de la neutralité, 1995, deutsch 1997). 41Vom Widerstandsgeist gegen den italienischen Faschismus und Irredentismus geprägt waren Guido Calgari und Mario Agliati, die 1969 eine Storia della Svizzera vorlegten.
Ihre Hauptwirkung verdankte die Nationalgeschichte, welche die Geistige Landesverteidung der 1930er-Jahre in den Kalten Krieg transportierte, allerdings weniger der Geschichtsschreibung, selbst wenn sie volkstümlich präsentiert wurde, als dem Schulunterricht und den pädagogischen Schriften etwa des Schweizerischen Jugendschriftenwerks SJW (so 650 Jahre Eidgenossenschaft, 1941). Der Lehrplan für die Berner Primarschulen, der von 1947 bis 1982 gültig war, hielt fest: «Die nationale Aufgabe erfüllt der Geschichtsunterricht in unserem Vaterlande dann, wenn er zum guten Eidgenossen erziehen hilft. Zum guten Eidgenossen gehört das eidgenössische Bewusstsein. Dieses beruht auf einer gewissen Kenntnis der Wesenszüge unseres Staates und unserer Geschichte, aber auch auf einem Empfinden der Unterschiede zwischen uns und den andern.» 42In einem für den Schulunterricht verfassten Buch, Wir wollen frei sein wie die Väter waren, forderte Franz Meyer 1961, den historischen Vorbildern zu folgen: «Auch wir sind bereit, für unser Vaterland Opfer zu bringen, für das Heimatland auf etwas zu verzichten, dem Lande einen Dienst zu erweisen und für die Heimat zu beten. Nur so verdienen wir es, in einem freien Lande leben zu dürfen.» Meyer rettete die mittelalterlichen Legenden zumindest in ihrem didaktischen Kern: «Wir wissen, dass die mündliche Überlieferung Fehler und Ungenauigkeiten enthalten kann. […] Und trotzdem sind diese Geschichten wahr. Das Volk der Hirten stand auf, starke Landammänner führten es, und mutige Helden setzten ihr Leben ein für die Freiheit dieses Volkes.» 43In der Wissenschaft waren solche Positionen nicht mehr haltbar, nachdem der Zürcher Professor Marcel Beck das Vorgehen Karl Meyers und seiner Schule zerzaust hatte. Der Beck-Schüler und Schriftsteller Otto Marchi popularisierte den Kenntnisstand 1971 mit seiner Schweizer Geschichte für Ketzer.
In der Schule dagegen machte die heroische Verteidigung der Freiheit gegen die Habsburger und andere fremde Bedrohungen lange den Hauptteil des schweizergeschichtlichen Unterrichts aus. Die Moral aus der Masslosigkeit der Söldner und der Niederlage von Marignano war die Neutralität, die als aussenpolitischer Grundzug danach die Narration bestimmte, unterbrochen nur durch Napoleon, der die «Franzosenzeit» um 1800 repräsentierte. Die internen Gegensätze wurden gleichsam von der harmonischen Versöhnung her erzählt und aufgefangen: vom Stanser Verkommnis bis zum «Friedensabkommen» in der Metallindustrie von 1937. Die schweizergeschichtlichen Schulbücher begannen sich erst seit den 1970er-Jahren allmählich zu ändern. Die Schweiz wurde als Teil ihrer europäischen Umwelt vorgestellt, ihre Vergangenheit nicht auf das Militärische reduziert, und bei der Behandlung der Helvetik (1798–1803) kamen nun auch positive Aspekte zur Sprache. 44
Diese Veränderungen fügten sich in einen allmählichen Wandel, der greifbar wurde, wenn sich Brüche im nationalen Geschichtsbild auftaten. Ein politischer Reflex bestand dann jeweils darin, dass der Bundesrat in der internationalen Tradition der «Weissbücher» historische Fakten von Fachleuten abklären liess. 45So verfasste der frühere Basler Regierungsrat Carl Ludwig 1957 einen nach ihm benannten Bericht über die schweizerische Flüchtlingspolitik im Krieg, als die offizielle Publikation der Akten zur deutschen auswärtigen Politik in der Bundesrepublik belegte, dass der J-Stempel in Pässen deutscher Juden 1938 auf schweizerische Anregung eingeführt worden war. Als weitere Aktenpublikationen und ein Buch des englischen Journalisten Jon Kimche die Neutralitätspolitik im Krieg in ein fragwürdiges Licht stellten, veranlasste die Landesregierung einen prominenten Zeitzeugen, den Basler Geschichtsprofessor Edgar Bonjour, seine Geschichte der schweizerischen Neutralität zu verfassen. Er erhielt ungehinderten Zugang zu den Archiven, doch der Bundesrat willigte in die Veröffentlichung des Berichts ab 1967 erst ein, nachdem Medien und Parlamentarier dies eindringlich gefordert hatten. Die letzten drei Bände, die für die Kriegszeit relevant waren, erschienen auch auf Französisch. Bonjour zeigte sich durchaus kritisch gegenüber einzelnen Aspekten der bundesrätlichen Politik im Krieg. Ihre Gesamtbeurteilung konzipierte er allerdings als folgerichtige Fortsetzung seiner schon früher verfassten Darstellung der schweizerischen Neutralität, die er – wie Paul Schweizer 1895 – möglichst früh, nämlich mit Niklaus von Flüe beginnen liess. So konnte er das Fazit aus den Kriegsjahren ziehen, dass die Neutralität nicht nur mitentscheidend gewesen sei für die Wahrung der Selbständigkeit, sondern dass die Verpflichtungen, die sich aus ihr ergaben, gegenüber dem Ausland erfüllt worden seien. 46
Читать дальше