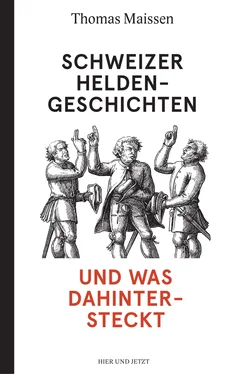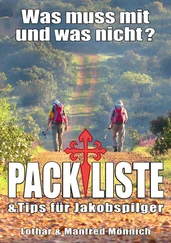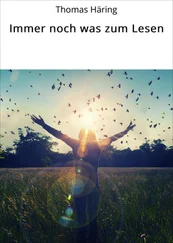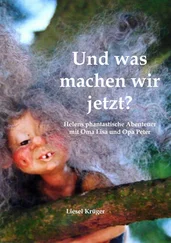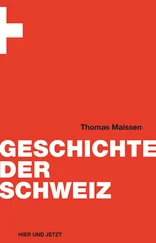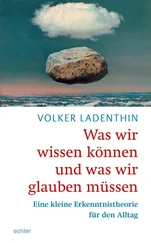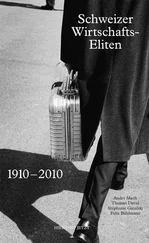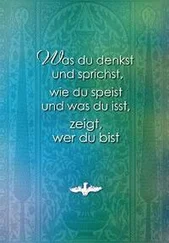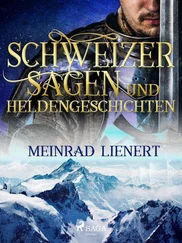Zu strengeren Urteilen kamen in denselben Jahren um 1968 eine wachsende Zahl von Journalisten und Schriftstellern wie Walter Matthias Diggelmann, Christoph Geiser, Max Frisch und Niklaus Meienberg, die ihre publizistischen Finger in die unheroischen Wunden der Kriegszeit legten. 47Die Historikerzunft griff diese heiklen Themen etwas später auf, in den 1980er-Jahren, nachdem die Sperrfrist im Bundesarchiv auf 35 Jahre reduziert worden war und ab 1979 die zahlreichen Bände der Diplomatischen Dokumente der Schweiz (von 1848 bis 1945, gegenwärtig fortgesetzt bis 1989) das dort gesichtete Quellenmaterial gedruckt zugänglich machten. Autoren wie Werner Rings oder Jakob Tanner untergruben die Doktrin, dass die wirtschaftliche Kooperation mit dem Dritten Reich nur den Geboten der Not gehorcht hatte. Markus Heiniger behandelte 1989 Dreizehn Gründe. Warum die Schweiz im Zweiten Weltkrieg nicht erobert wurde. Seine Antwort liess sich auf die Formel reduzieren: wirtschaftliche Dienstleistungen und militärische Bedeutungslosigkeit. Georg Kreis und Hans Ulrich Jost sprachen vom «Helvetischen Totalitarismus», um das Vollmachtenregime und den Geist der Kriegsjahre zu charakterisieren.
Aufsehen erregte dies auch deshalb, weil Jost diese Formulierung 1983 im Referenzwerk Geschichte der Schweiz und der Schweizer wählte. Es wollte das solide, aber stark ereignis- und verfassungsgeschichtlich angelegte Handbuch der Schweizer Geschichte (1972/1977) ergänzen, wenn nicht sogar ablösen. Ausländische Einflüsse, vor allem das Modell einer «histoire totale» im Sinn der französischen Annales-Schule, prägten das Konzept der Geschichte der Schweiz und der Schweizer, die auf Deutsch, Französisch und Italienisch erschien. Sie wertete die politische und militärische Geschichte der «grossen Männer» ab zugunsten der langfristigen Entwicklungen, die den Alltag der «normalen Menschen» bestimmten und möglichst mit quantitativen Quellen und statistischen Methoden erfasst wurden: Bevölkerungsentwicklung, Wirtschaft, sozialer Wandel, Mentalitäten. Für viele dieser Phänomene war der Nationalstaat Schweiz nicht der geeignete Darstellungsrahmen, weil es zwischen den Landesteilen sehr viele Unterschiede gab. Die Verschiebung der Erkenntnisinteressen trug dazu bei, dass die Nationalgeschichte im folgenden Vierteljahrhundert erheblich an Bedeutung verlor. Für eine «histoire totale» eigneten sich die Kantone besser, deren Geschichte zum Gegenstand eines eigentlichen Wettbewerbs um die gründlichste Erforschung und höchststehende Präsentation wurden. Sie integrierten weitere neue Ansätze, etwa die Frauen- und Geschlechtergeschichte. Beatrix Mesmer war eine Mitherausgeberin der Geschichte der Schweiz und der Schweizer, doch Beiträge aus weiblicher Hand zu schweizergeschichtlichen Gesamtdarstellungen finden sich erstmals im Handbuch Die Geschichte der Schweiz, das Georg Kreis 2014 herausgegeben hat.
Praktisch alle diese neuen Schweizer- und Kantonsgeschichten umfassten mehrere Bände, in denen Experten die jeweiligen Epochen behandelten. Diese Spezialisierung war wie die neuen inhaltlichen und methodischen Interessen ein Zeichen dafür, dass die schweizerischen Geschichtswissenschaftler Anschluss an internationale Entwicklungen fanden. Schweizergeschichte war nicht mehr ein Geschäft für sich, das als Entfaltung der Nation über die Jahrhunderte hinweg verfolgt wurde, sondern unterteilte sich mit einem vergleichenden Blick auf ausländische Forschungen in eigenständige Epochen. In der universitären Lehre und in ihren Prüfungen waren nicht unbedingt Themen aus der Schweiz stark rückläufig, wohl aber solche der Nationalgeschichte. Der Internationalisierung entsprach es, dass die Zeitschrift für schweizerische Geschichte schon 1951 einen neuen Namen erhielt: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte. Das Historische Lexikon der Schweiz, welches das Historisch-Biographische Lexikon der Schweiz (1921–1934) ablöste und von 2002 bis 2014 in drei Landessprachen erschien, behandelte nicht nur die vielen Personen und Orte im Land, sondern präsentierte in Sachartikeln Phänomene, die bereits im Ausland Gegenstand der Forschung geworden waren.
Wie stark sich das populäre Geschichtsbild und die universitäre Forschung auseinandergelebt hatten, zeigte sich 1986 beim Jubiläum der Schlacht bei Sempach, dann 1989, im Umfeld des Mauerfalls und der Armeeabschaffungsinitiative, und 1991 bei der Jubiläumsfeier «700 Jahre Eidgenossenschaft», die in ihrer ursprünglich geplanten Form scheiterte. 1995 wurde die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg gar zum Thema internationaler Polemiken. Vor allem Amerikaner formulierten Anschuldigungen über die schweizerische Kollaboration mit Nazideutschland, die zum Teil aus der Luft gegriffen waren und zum Teil auf solider Quellengrundlage beruhten. Dazu gehörte kaum etwas, was den Fachleuten nicht bekannt gewesen wäre. Aber weite Kreise, nicht zuletzt viele Angehörige der Aktivdienstgeneration, die damals Militärdienst geleistet hatten, empfanden die Weltkriegsdebatte als Demütigung der Schweiz und ihrer Leistungen im Weltkrieg. Der Bundesrat setzte erneut eine Kommission zur «historischen Wahrheitsfindung» ein, die von Jean-François Bergier geleitet wurde. Sie legte 2002/03 in zahlreichen Einzeluntersuchungen und einem Schlussbericht ihre Einschätzung vor, wie sich die Schweiz, namentlich ihre Unternehmen und der Finanzplatz, verhalten hatte. Die Konfrontation mit dem Forschungsstand führte zu heftigen öffentlichen Debatten: «Junghistoriker» erschienen den einen als besserwisserische «Nestbeschmutzer» und marxistische «Schweizhasser», während die anderen forderten, endlich mit den Geschichtsmythen aufzuräumen. 48
Geschickt nutzten vor allem die Schweizerische Volkspartei (SVP) und ihre Schwesterorganisation, die Aktion für eine neutrale und unabhängige Schweiz (AUNS), das vergangenheitspolitische Thema, das viele als Frage der nationalen Ehre ansahen. Ihr Anführer Christoph Blocher ordnete die Auseinandersetzung um Entschädigungszahlungen und deren Gegenstand in den jahrhundertelangen Widerstand gegen Aggressoren und in diesem Fall «Erpresser» aus dem Ausland ein. Diese Argumentation fügte sich gut in das rhetorische Abwehrdispositiv, das die Nationalkonservativen bereits gegenüber dem Europäischen Wirtschaftsraum (1992) und gegenüber der Europäischen Union pflegten, in der sie eine zentralistische und imperialistische Grossmacht erblickten. Diese Überzeugung ergab sich nicht aus neuen historischen Publikationen oder eigenständigen Forschungen. Im Gegenteil, die Nationalkonservativen wiederholten bloss, aber mit anhaltendem Erfolg die Kernelemente des Geschichtsbilds, wie es im Kalten Krieg für die politischen Parteien bis weit in die Linke hinein und für grosse Teile der Bevölkerung Gültigkeit gehabt hatte. Einleitend zu den hier folgenden Kapiteln wird diese Position jeweils durch ein Zitat der beiden SVP-Bundesräte Christoph Blocher oder Ueli Maurer illustriert. Es bildet den Ausgangspunkt zu den folgenden Überlegungen, ob und wie weit die schweizerischen Heldengeschichten der historischen Überlieferung entsprechen und angemessene Modelle für die Zukunft liefern.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.