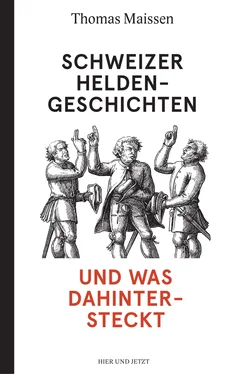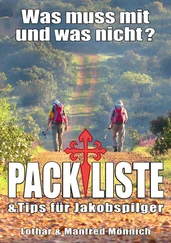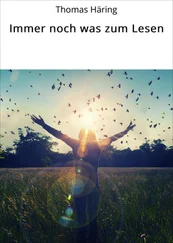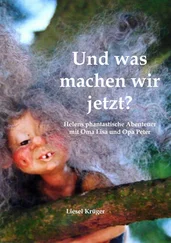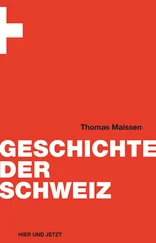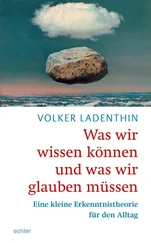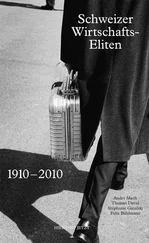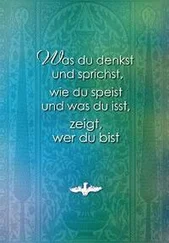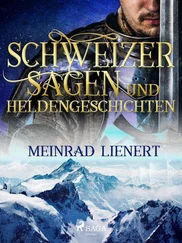In den zwei Folianten Gemeiner loblicher Eydgnoschaft Stetten, Landen und Völckeren chronickwirdiger thaaten beschreybung, gedruckt in Zürich 1548, erweiterte Stumpf Tschudis Helvetierthese insofern, als er das Kollektiv, das seit jeher seine «althärgebrachten Freyheiten» verteidigte, als ein «Alpenvolck» im «Alpenland» bezeichnete. 28Durch diese Rückbindung an die Landestopografie war die Ethnisierung eines Bündnisses vollzogen, das vor allem Reichsstädte prägten, die mit den Alpen wenig zu tun hatten. Es entsprach aber der Wertschätzung der heimischen Alpen als Ort der göttlichen Offenbarung und seiner Majestät bei den Zürcher Reformatoren Ulrich Zwingli, einem gebürtigen Toggenburger, bei dessen Nachfolger Heinrich Bullinger, zugleich Verfasser einer ungedruckten Eidgenössischen Chronik (1568), oder bei dessen Schwiegersohn Josias Simler, der 1574 ein Werk De Alpibus vorlegte.
Es ist ebenso auffällig wie bezeichnend, dass Bullinger, Simler und Vadian, der Reformator von St. Gallen, in historiografischen Fragen eng mit Aegidius Tschudi zusammenarbeiteten, dem Anführer der Glarner Katholiken und um 1560 Namensgeber des «Tschudikriegs», der seinem Heimatkanton beinahe einen konfessionellen Bürgerkrieg bescherte. Diese erste Generation von humanistisch geprägten Reformatoren und Gegenreformatoren arbeitete ebenso wie die Chronisten um 1500 noch zusammen, um eine solide säkulare Geschichte als verbindende Klammer für die Eidgenossen zu formulieren, wenn schon deren transzendentale Verbindung im gemeinsamen religiösen Eid und Bekenntnis verloren war. Auch deshalb konnten sich die sagenhaften Elemente der Befreiungsgeschichte um Tell als zentrale Bestandteile der schweizerischen Geschichte halten. Denn trotz gelegentlichen Zweifeln waren selbst die Reformierten nicht bereit, solche glorreichen Bezüge zu den eidgenössischen Anfängen preiszugeben. Sogar Bruder Klaus, der 1649 selig gesprochen wurde, blieb im konfessionellen Zeitalter eine vorbildliche Figur, auf die sich beide Glaubensparteien bezogen. Ein weiteres Anliegen verband die Historiker über die Konfessionsgrenzen hinweg. Sie stellten die Kämpfe gegen die Habsburger nicht als illegitime Revolte gegen den Adel dar, sondern als gebotenen Widerstand der ordnungsliebenden Eidgenossen gegen die habsburgischen Usurpatoren. Besonders Tschudi und Simler, dessen Regiment der lobl. Eÿdgenossschaft (1576) oft aufgelegt und übersetzt wurde, betonten, dass die Eidgenossen nicht anarchische Bauern waren, sondern viele Vornehme und auch Adlige zu sich zählten. Das war besonders wichtig in einer Zeit, in welcher Habsburger wie Kaiser Karl V. oder Philipp II., der König von Spanien und Herrscher in Mailand, der Eidgenossenschaft wieder gefährlich werden konnten.
So blieb der kriegerische Gegensatz zu den habsburgischen Tyrannen, wie er nach dem Alten Zürichkrieg formuliert und zuletzt von Tschudi übernommen worden war, ein Grundmotiv des schweizerischen Geschichtsverständnisses. Veränderungen fehlten auch deshalb, weil die Geschichtsschreibung über die Eidgenossenschaft nach den umfassenden und soliden Veröffentlichungen von Stumpf und Simler weitgehend ruhte. Nur zeitlich über sie hinaus führten der Basler Andreas Ryff (Cirkell der Eidtgnoschaft, 1597, ungedruckt) oder der Zürcher Johann Heinrich Rahn (Eidtgnössische Geschicht-Beschreibung, 1690). Sogar die Illustrationen übernahm der Wettinger Abt Christoph Silberysen für seine Schweizerchronik von 1576 aus Stumpfs Werk. Die amtliche Geschichtsschreibung dagegen widmete sich wieder vorwiegend der Geschichte der eigenen Stadt, in der die alles dominierende religiöse Wahrheitsfrage gelöst und nicht, wie in der eidgenössischen Geschichtsschreibung, konfliktträchtig war. Über die lokale Perspektive hinaus blickte man namentlich in Bern, wo Valerius Anshelm mit seiner ungedruckten Chronik (verfasst 1529–1547) und sein Fortsetzer Michael Stettler (Schweitzer Chronic, 1627) in Justingers Fussstapfen traten und eine klare protestantische Position vertraten. Ein habsburgfreundlicher Autor wie der Freiburger François Guillimann wanderte frustriert nach Freiburg i. Br. aus, nachdem sein Werk De rebus Helvetiorum sive Antiquitatum libri V (1598) sich nicht einmal unter Katholiken als Gegenstimme zu den Zürcher Historikern etablieren konnte.
Erst die um 1700 einsetzende Frühaufklärung brachte ein neues Interesse an der gesamteidgenössischen Vergangenheit hervor, das über konfessionelle Differenzen hinwegzuschauen bereit war. Der Zürcher Johann Jacob Scheuchzer erforschte in seiner Beschreibung der Natur-Geschichten des Schweizerlandes (1706) nicht nur die Topografie der Alpen, sondern formulierte die These eines «Homo alpinus Helveticus»: Der schweizerische Alpenhirt sei dank seiner einfachen Lebensweise nicht nur gesund, kräftig und tapfer, sondern auch tugendhaft und fromm – und politisch frei, was die Schweizer unabhängig von der Religionsfrage grundsätzlich verband. 29Von Albrecht von Haller über Salomon Gessner und Jean-Jacques Rousseau bis zu Friedrich Schiller trugen Dichter zu dieser helvetischen Version des edlen Wilden bei, wie ihn die Aufklärung dem dekadenten Höfling als Gegenbild gegenüberstellte. Da insbesondere Frankreich und seine höfische Kultur diese Figur hervorbrachten, richteten sich der Patriotismus und der Helvetismus des Berners Beat Ludwig von Muralt, des Zürchers Johann Jacob Bodmer, des Luzerners Franz Urs Balthasar und vieler anderer Aufklärer gegen das Fremde, «Unschweizerische». Wenn es, wie beim Solddienst, bei korrupten Amtsleuten oder unduldsamen Klerikern, in der Schweiz selbst zu greifen war, geschah dies umso strenger. In Abgrenzung dazu formulierten die Aufklärer das Ideal sittenreiner republikanischer Selbstbestimmung, die nicht nur die Barrieren der Konfession überwinden sollte, sondern auch diejenigen der Sprache. So zählte die 1762 gegründete Helvetische Gesellschaft, die erste «nationale» Sozietät, neben Reformierten auch einige städtische Katholiken sowie den Waadtländer Pfarrer Philippe-Sirice Bridel zu ihren Mitgliedern. Der frühere «grosse pund obertütscher landen» wurde so allmählich als zweisprachig wahrgenommen in dem Sinn, dass die romanischen Sprachen nicht mehr zwingend ein Zeichen von Untertänigkeit waren.
Dass Bridel zu den Gründern der Geschichtsforschenden Gesellschaft der Westschweiz zählte, war kein Zufall. Die Erforschung der vaterländischen Geschichte war ein Hauptanliegen der Aufklärer, mit dem Ziel, ein neues Nationalgefühl historisch zu begründen. Johann Jacob Bodmer, der auch historische Dramen über Schweizer Helden verfasste und den Volkscharakter in der Alpenlandschaft begründet sah, wirkte mit Lehrbüchern bis hinein in die Realschule. Er gab ab 1735 die erste historische Zeitschrift der Schweiz heraus, die Helvetische Bibliothek, und weitere Sammlungen, die Quellen und ältere Geschichtswerke «zur Historie der Eidgenossen» vereinten. Damit standen Bodmer und sein Mitstreiter Johann Jacob Breitinger nicht allein. Sie gaben postum die Helvetische Geschichte des Berners Jacob Lauffer heraus, eine Kompilation aus ihm zugänglichen Vorgängerwerken. Weitere Werke wie die Historie der Eydgenossen (1758) des Vincenz Bernhard von Tscharner erschienen ebenfalls aus Berner Federn. Viel wichtiger war allerdings Gottlieb Emanuel von Hallers systematische Bibliothek der Schweizer-Geschichte (1788), das erste umfassende Verzeichnis der einschlägigen handschriftlichen und gedruckten Darstellungen und Quellen. Sie beruhte unter anderem auf Bodmers reichhaltigen Notizen und fügte sich ein in eine reiche Editionstätigkeit der Aufklärer. Etterlins Kronika wurde gleich zweimal (1752 und 1764) nachgedruckt. Vor allem aber gab der Basler Johann Rudolf Iselin 1734/36 erstmals Tschudis Hauptwerk als Chronicon Helveticum in den Druck; dessen Vorgeschichte der Schweiz erschien als Gallia comata ebenfalls erstmals gedruckt 1758 in der Edition von Johann Jacob Gallati. Der künftige Zürcher Bürgermeister Johann Jacob Leu gab nicht nur Josias Simlers Regiment der Lobl. Eÿdgenoschaft 1722 und 1734 aktualisiert und kommentiert heraus, sondern stellte auch ein Allgemeines Helvetisches Eydgenössisches … Lexikon (1747–1765) in zwanzig Quartbänden zusammen. Dafür erbat er Informationen aus allen Kantonen, erhielt sie aber nicht aus allen – oft galt historisches Wissen noch als Geheimwissen, zumal bei Leu und anderen Autoren nun zunehmend Gewicht auf der Verfassungsentwicklung lag. Wie im 16. Jahrhundert erfolgte diese gemeineidgenössische Suche nach den historischen Wurzeln konfessionsübergreifend, sodass der Luzerner Joseph Anton Felix Balthasar oder der Zuger Beat Fidel Anton von Zurlauben (Tableaux topographiques, 1780–1788) als wichtige Korrespondenten von Hallers involviert waren. Erstmals beteiligt waren auch Vertreter der französischsprachigen Schweiz wie Abraham Ruchat, dessen Landeskunde Les délices de la Suisse (1714) im Ausland wirkungsmächtiger war als die zahlreichen Veröffentlichungen von Deutschschweizern.
Читать дальше