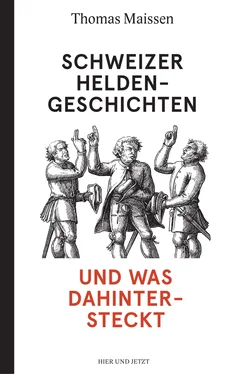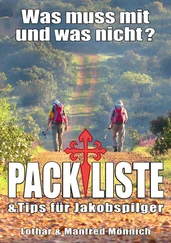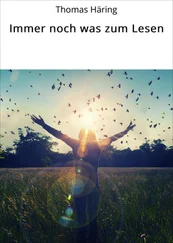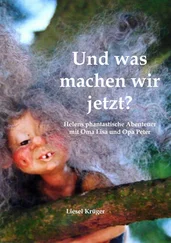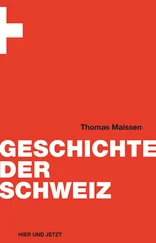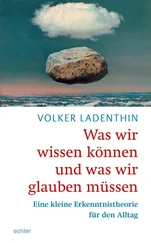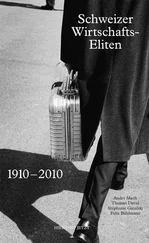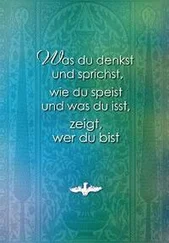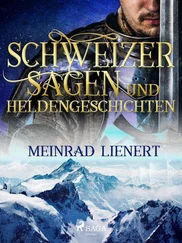Von diesem Urteil auszunehmen sind jedoch die weit über die Landesgrenzen hinaus wirkungsreichen Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft (1780–1808) des Schaffhauser Aufklärers Johannes (von) Müller. Er zog gleichsam die Summe aus den vielen Texten, die im 18. Jahrhundert neu zugänglich wurden, und ordnete diese in die Fragestellungen zu Landesbeschaffenheit, Volks- und Zeitgeist, Verfassungswandel und Vergänglichkeit ein, die Montesquieu und andere Aufklärer formuliert hatten und die in der Revolutionszeit hochaktuell waren. Müller stand selbst in den Diensten deutscher Fürsten und wurde 1791 vom Kaiser geadelt. Die Geschichte seiner Heimat, die er bei seinem Tod von den Helvetiern bis 1493 erzählt hatte, stilisierte er dagegen als kollektive Verwirklichung der Freiheit, die «unsere Väter durchaus und einmüthig», treu und tapfer, tugendhaft, patriotisch und christlich-fromm zu wahren wussten. Das so gezeichnete Vorbild der Alten sollte im Untergang der Alten Eidgenossenschaft und während der krisenhaften Helvetischen Republik volkspädagogisch Orientierung stiften. Nicht ein Fürst, sondern das schweizerische Volk in der durch die Alpen geprägten «Untilgbarkeit seines Nationalcharakters» war Hauptdarsteller und fand in einer freiheitlichen Verfassung seine wesensgemässe Bestimmung. Das trug im Umfeld von Französischer Revolution und Romantik zum enormen Erfolg des vielbändigen Werks vor allem in Deutschland bei. 30Schillers Wilhelm Tell beruhte auf dem «glaubenswerten Mann» Johannes Müller, wie er augenzwinkernd im Drama genannt wird, und über ihn auf Tschudi.
Dass v. Müller für Jahrzehnte die literarischen und moralischen Standards der Schweizer Geschichte gesetzt hatte, zeigte sich an den zahlreichen Fortsetzungen und Aktualisierungen seines Werks, die Robert Glutz-Blotzheim, Johann Jakob Hottinger, Louis Vulliemin und Charles Monnard in den Jahrzehnten bis 1851 verfassten. Letzterer übersetzte v. Müller auch ins Französische, und 1853 lagen umgekehrt diese Fortsetzungen auch auf Deutsch vor, sodass dem jungen Bundesstaat gleichsam eine zweisprachige Darstellung seiner Vorgeschichte bis ins frühe 19. Jahrhundert zur Verfügung stand. Die Schilderung des Gemeinsinns jenseits der Egoismen und der verbindenden christlichen Religion als dauerhafter sittlicher Basis trat an die Stelle von konfessionspolitischen Untertönen und Polemiken, auch wenn die Nationalgeschichte im 19./20. Jahrhundert eine Domäne von protestantischen Historikern blieb. Freiheit war ihr Leitmotiv, aber die elitären, religiösen und föderalistischen Autoren verstanden darunter keine Freiheit, die auf die nationale Demokratie enggeführt worden wäre. Die populäre Vermittlung v. Müllers und nicht zuletzt der Befreiungslegende war dagegen die Mission des aus Magdeburg eingewanderten liberalen Pädagogen und Politikers Heinrich Zschokke, über seine publizistische Tätigkeit für den Schweizerboten ebenso wie in Des Schweizerlands Geschichte für das Schweizervolk (1822). Sein Lob des Volkes, das sich seiner Überlieferung verpflichtet fühlen und von seinen Nachbarn abgrenzen solle, hatte einen grossen Erfolg und inspirierte vaterländische Feiern ebenso wie Volkslieder und Historiengemälde. Über die Sprachgrenze hinweg wirkte Zschokke ab 1849, als der liberale Freiburger Katholik Alexandre Daguet dessen Schweizergeschichte in einer französischen Bearbeitung vorlegte.
Ebenfalls ein Katholik, allerdings ein Konservativer, der Luzerner Joseph Eutych Kopp, verwarf 1835 in Urkunden zur Geschichte der eidgenössischen Bünde nicht nur Tell, sondern auch den Rest der Befreiungslegende, wie sie v. Müller, Zschokke und andere besungen hatten, die der Urschweiz durch Herkunft und Mentalität viel ferner standen als Kopp. Seine Quelle war nicht mehr die ältere Historiografie, sondern das Archiv mit seinen Urkunden. Das entsprach der Verwissenschaftlichung der Geschichtsschreibung, wie sie vor allem in Deutschland betrieben wurde und die jede Epoche, mit Leopold von Ranke gesprochen, als «unmittelbar zu Gott» betrachtete. Das galt auch für das Mittelalter, das Kopp nicht nationalgeschichtlich auf eine Gründungsphase der Schweiz reduzieren wollte. Zu den Urkunden, die er edierte oder mit einem neuen Blick würdigte, gehörte auch der Bund von Uri, Schwyz und Unterwalden von 1291, dem er aber wenig Bedeutung beimass. Er zeichnete ein positives Bild von den Habsburgern, und in den mittelalterlichen Urkunden entdeckte er nicht die Vorgeschichte einer liberalen Schweiz, sondern eine offene Situation mit vielen Akteuren und zeitgebundenen, kurzfristigen Zielen.
Kopp begründete 1839 die Eidgenössischen Abschiede, die Sammlung der Beschlussprotokolle, die bei den Treffen der Eidgenossen und später der Tagsatzung angefertigt worden waren. Ein anderer Luzerner, Philipp Anton von Segesser, setzte diese Edition später fort, die als Langzeit-Editionsprojekt des Bundes schliesslich alle Abschiede bis ins Jahr 1848 umfassen sollte. Dieses Datum betrachteten die ersten Bearbeiter der Abschiede mit gemischten Gefühlen, die Alte Eidgenossenschaft dagegen nicht ohne Nostalgie. Segesser war der Anführer der katholisch-konservativen Verlierer des Sonderbundskriegs im schweizerischen Parlament und Verfasser von Werken vor allem zu Luzern, das ihm als Heimat näher stand als der neue Bundesstaat. Der Konfessionalismus und Föderalismus von Segesser und Kopp sowie ihre Bewunderung für imperiale Strukturen verweigerten sich durch den Rekurs auf sperrige Urkunden den zielgerichteten Nationalgeschichten der Liberalen. Letztere suchten in den neu greifbaren Quellen die Bestätigung dessen, was sie im Mythos vorgegeben fanden. Dessen Ursprung fanden die beiden Zürcher Historiker Gerold Meyer von Knonau und Georg von Wyss 1854 praktisch gleichzeitig im Weissen Buch von Sarnen, um sich dann über die Rolle des Entdeckers zu zerstreiten.
Von Wyss verwies zugleich die Gründungslegende der Waldstätte in das Reich der Phantasie, weil sie urkundlich nicht belegt war. Die «kritische Schule» verwirklichte sich nicht zuletzt dank Institutionen: Um die Jahrhundertmitte wurden an den jungen Universitäten historische Seminare gegründet, oft mit eigenen Professuren für die vaterländische Geschichte. Diese verdankten ihre Methode Studienjahren in Deutschland, wo der deutsche Historismus um Ranke die systematische Quellenkritik vorbildlich vermittelte. Neben kantonale traten nun nationale Gesellschaften und Zeitschriften, namentlich die Allgemeine Geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz (1841) und ihr Jahrbuch, später die Zeitschrift für schweizerische Geschichte. Archive wurden als Teil der demokratischen Öffentlichkeit und Transparenz für das Publikum geöffnet. 1849 erhielt das 1798 gegründete Bundesarchiv in Bern seinen eindeutigen Auftrag. Manche Editionen von ungedruckten Quellen, nicht zuletzt der mittelalterlichen Chronistik, erblickten das Licht, finanziert von staatlichen Institutionen. Die Impulse waren dieselben wie in den anderen entstehenden Nationalstaaten Europas, die ihre Anfänge möglichst weit zurück ins Mittelalter verlegten. Sie wollten ihr Territorium und gegebenenfalls territoriale Ansprüche gegen aussen rechtfertigen und im Inneren eine Volksgemeinschaft postulieren, die sich nicht durch die wachsenden Klassengegensätze auseinanderdividieren liess. Ebenso wichtig war es für die Schweiz im Zeitalter der deutsch-französischen «Erbfeindschaft», die historischen Gemeinsamkeiten der verschiedenen Sprachgemeinschaften auf ihrem Territorium zu entdecken und für die «Willensnation» zu betonen.
Gerade wegen der internationalen Konkurrenz auch in den Geisteswissenschaften war Wissenschaftlichkeit gefragt. Die Historiografie wandte sich ab von der literarisch möglichst ansprechenden oder zumindest eingängigen Nacherzählung dessen, was andere Historiker schon überliefert hatten. Wichtig wurde die Erforschung von neuen Themen, die sich möglichst auf Urkunden und andere Realien aus der Untersuchungszeit stützte. Ein Winter mit niedrigem Wasserstand brachte am Zürichsee Reihen von Pfählen und andere Siedlungsreste zum Vorschein. Ferdinand Keller veröffentlichte auf dieser Grundlage 1854 Die keltischen Pfahlbauten in den Schweizerseen. Wie der Titel besagte, hatte man es bei den Pfahlbauten (die heutige Archäologen nicht mehr als solche ansehen) mit einem Phänomen zu tun, das (nur) für die «Schweiz» charakteristisch war. Zeitlich vor den Helvetiern und wissenschaftlich solider, da nicht nur bei Geschichtsschreibern belegt, trat so im jungen Bundesstaat eine nationale Urbevölkerung auf den Plan, die vor allem in populären Darstellungen ebenfalls als Projektionsfläche für helvetische Tugenden und Freiheitsliebe dienen konnte.
Читать дальше