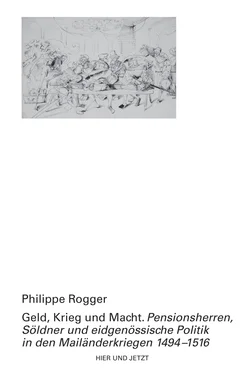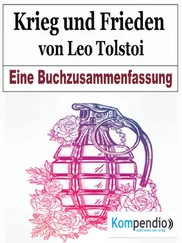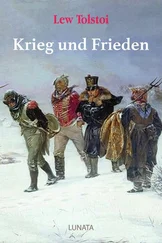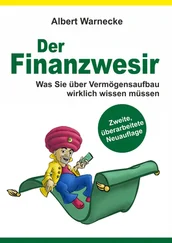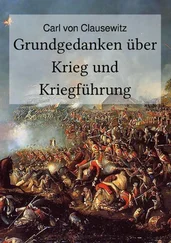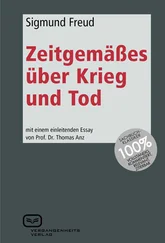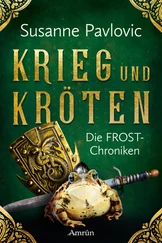Philippe Rogger - Geld, Krieg und Macht
Здесь есть возможность читать онлайн «Philippe Rogger - Geld, Krieg und Macht» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Geld, Krieg und Macht
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Geld, Krieg und Macht: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Geld, Krieg und Macht»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Geld, Krieg und Macht — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Geld, Krieg und Macht», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Erheblich mehr Raum als in der Solothurner Geschichtsschreibung nehmen die Unruhen in der Kantonsgeschichtsschreibung von Zürich ein. Auch hier beginnt die Aufarbeitung der Ereignisse im 16. Jahrhundert. Mit Johannes Stumpf, 109Heinrich Bullinger 110und Hans Füssli 111widmeten sich drei Zürcher Chronisten dem sogenannten Lebkuchenkrieg. Alle drei Darstellungen fokussieren nebst der Ereignisgeschichte insbesondere auf das umstrittene Verhalten der angeklagten Zürcher (Bestechungen etc.). Auffallend dabei ist, dass in keinem der drei Werke der Einigungsvertrag zwischen Obrigkeit und Aufständischen (Mailänderbrief) diskutiert wird. 1121910 diagnostizierte Karl Dändliker in seiner Geschichte der Stadt und des Kantons Zürich «ein soziales oder wirtschaftliches Missbehagen» 113und kontextualisierte die Unruhen vor dem Hintergrund der Zürcher Verfassungsgeschichte. Seiner Einschätzung zufolge hatte die ökonomische Belastung der Untertanen seit dem Waldmannhandel «keine Erleichterung erhalten; die wirtschaftliche Gebundenheit und Zurücksetzung, sowie der allgemeine Notstand drückten nach wie vor.» 114Aus dem «Gefühl der Verbitterung über die Ungerechtigkeit, die darin lag, dass man die ‹Reiser›, die frei nach Sold und Beute jagten, bestrafte, ja schwer traf, während man den vornehmen Herren ruhig und ungehindert reiche Pensionen vom Auslande her zufliessen liess», 115resultierte der Mailänderbrief, eine «der wichtigsten Verfassungsurkunden unserer älteren Kantonsgeschichte.» 116Anton Largiadèr betonte zehn Jahre später in seiner Arbeit über die zürcherische Landeshoheit, dass 1515 im Unterschied zu den Untertanenprotesten in der Reformationszeit ausschliesslich politische Fragen verhandelt worden und wirtschaftliche Beschwerden ganz in den Hintergrund getreten seien. 117In dieser Frage herrscht in der Zürcher Historiografie seither weitgehend Konsens. Dass sich der Konflikt in Zürich 1515 im Unterschied zum Waldmannhandel 1489 – aber auch im Gegensatz zu den Unruhen in Bern, Luzern und Solothurn von 1513 – auf politische Inhalte (Pensionenwesen, Schuldfrage an der Niederlage in Marignano) beschränkte, lässt sich gemäss der Arbeit von Christian Dietrich damit erklären, «dass eine grundlegende Klärung der Stadt-Land-Beziehung auf der Basis der Anerkennung der gegenseitigen Rechtsansprüche schon 1489, bestätigt im ‹anbringen› von 1513, erfolgt war.» 118Heinzpeter Stucki, welcher den Lebkuchenkrieg für die 1996 erschienene Geschichte des Kantons Zürich bearbeitete, interpretiert den Mailänderbrief deshalb als eine Ergänzung zu den Waldmannschen Spruchbriefen. 119Die politische Erschütterung habe schliesslich, so bilanzieren Dietrich wie auch Stucki, einen Wandel in der zürcherischen Regierungspraxis bewirkt. Um einen Konsens in wichtigen Fragen bemüht, griff die Zürcher Obrigkeit nun vermehrt auf das Instrument der Ämteranfragen zurück. 120Obwohl in Zürich die Kompetenz des Rats in der Aussenpolitik nicht zur Debatte stand, bedeutete der Lebkuchenkrieg für die zürcherischen Aussenbeziehungen einen Richtungswechsel. «Durch ihn ward», resümiert Guido Stucki, «der in der Limmatstadt wie anderswo recht rührigen Franzosenpartei das Rückgrat gebrochen, was sich an einer fortan noch konsequenter gehandhabten anti-französischen bzw. kaiserlichen und päpstlichen Politik manifestierte.» 121
3
Die ältere Militär- und Kriegsgeschichte bekundete ein reges Interesse an den Pensionenunruhen. Bereits die Dissertation von Wilhelm Gisi aus dem Jahr 1866 interpretiert die Unruhen als Folge des diplomatischen und militärischen Engagements der Orte in den Mailänderkriegen. 122Ganz in dieser Tradition beurteilte Ernst Gagliardi in seiner wichtigen Arbeit Novara und Dijon. Höhepunkt und Verfall der schweizerischen Grossmacht im 16. Jahrhundert alle Forderungen der bernischen Aufständischen, die nicht im Zusammenhang mit dem Sold- und Pensionenwesen standen, als sekundär für den Ausbruch der Unruhen. 123Erst über die Zeit, so Gagliardi, habe «die Bewegung auch den sozialen Charakter erhalten, den ein Bauernaufstand in dieser Zeit unvermeidlich gewinnt», und «mit allem Nachgeben und schnellen Eingehen auf die ursprünglichen Ziele der Empörung konnte Bern es nicht verhindern, dass auch die übrigen Wünsche in so günstiger Stunde bei seinen Untertanen sich regten». 124
Eine Brücke zwischen Militär-, Wirtschafts-, Sozial- und Verfassungsgeschichte schlug Emil Dürr, indem er auf das latente Spannungsfeld zwischen aussenpolitischer Macht und innerer Verfasstheit des eidgenössischen Bündnisgeflechts zu Beginn des 16. Jahrhunderts hinwies. «Aussenpolitisch stand die Eidgenossenschaft auf der Ho(e)he ihrer Macht und ihres Ruhmes. Aber zur selben Zeit klafften in ihrem sozialen und staatlichen Gefu(e)ge so tiefe und so bedenkliche Risse auf, dass diese jene Grossmachtstellung von innen heraus problematisch gestalteten.» 125Dabei sah er einen eigentlichen «Demokratismus» am Werk, welcher sich mit einem politischen und wirtschaftlichen Konservatismus verbunden habe. So habe man «im Grunde die Ru(e)ckkehr zu a(e)lteren, u(e)berwundenen, als besser empfundenen Rechtsverha(e)ltnissen» angestrebt, wobei die Bauern und Landstädter die Kraft zum Aufstand und zum Widerstand «nicht zuletzt im Bewusstsein gescho(e)pft haben, dass es ja vor allem ihre Arme gewesen, welche die grossen Waffentaten und die politischen Erfolge der allerletzten Jahre erstritten hatten.» 126
Das in sämtlichen militärgeschichtlichen Darstellungen greifbare Unbehagen gegenüber dem Sold- und Pensionenwesen illustriert etwa die breit angelegte Untersuchung Emil Usteris zu Marignano aus dem Jahr 1974. 127Obwohl die Zürcher Prozesse im Nachgang des Lebkuchenkriegs gemäss Usteri einige Blicke hinter die Kulissen der Vorgänge während der Friedensverhandlungen in Gallarate erlauben würden, seien «gewisse Hemmungen zu überwinden». Gleichwohl müsse, so Usteri weiter, «auch diese dunkle Seite im Schweizer Geschichtsbuch aufgeschlagen und unparteiisch studiert werden.» 128Die Wirkung dieses Appells war innerhalb der militärhistorischen Zunft indessen beschränkt. In der neusten Überblicksdarstellung zu den Solddiensten kommen die Pensionenunruhen nicht zur Sprache. 129
4
Deutlich weniger Berührungsängste mit dem Gegenstand kennt die neuere Kultur- und Sozialgeschichte. Die Habilitationsschrift Valentin Groebners mit dem Titel Gefährliche Geschenke. Ritual, Politik und die Sprache der Korruption in der Eidgenossenschaft im späten Mittelalter und am Beginn der Neuzeit aus dem Jahr 2000 bedeutete einen eigentlichen Paradigmenwechsel. Groebner beurteilt die Aufstände im Unterschied zum bisherigen Deutungsangebot nicht mehr als Ausdruck einer durch das Pensionenwesen verursachten Krise, sondern interpretiert sie als Folge einer Verfestigung und Arrondierung der politischen Strukturen durch das Pensionenwesen. 130In Anlehnung an Groebner wies Claudius Sieber-Lehmann auf den Umstand hin, dass sowohl bei den Pensionenunruhen als auch beim Waldmannhandel nicht die grundlegenden Parameter des Systems beziehungsweise die Verfassungsformen (Kommunalismus, Republikanismus, Demokratie) zur Debatte standen, sondern vielmehr Handlungsweisen gedeutet wurden. «‹Interesse› im doppelten Sinne stand dabei im Vordergrund: Als Teilnahme am Spiel, aber – im Sinne des lateinischen interesse – auch als Profit.» 131Diese kultur- und sozialgeschichtliche Perspektive rückt die Bedeutung eines um materielle Ressourcen geführten Verteilungskampfes innerhalb eines immer stärker zugunsten der Obrigkeit strukturierten Sold- und Pensionenmarktes ins Zentrum. Sieber-Lehmann spricht deshalb von einem Spielfeld, im Sinn Bourdieus, mit ihm eigenen Verhandlungsregeln. 132Auch die neuste Untersuchung zum Könizer Aufstand von Hans Braun zielt nicht auf die Verfassungsformen ab, sondern nimmt die beteiligten Akteure und deren Handlungsweisen in den Blick. 133Aus dem bernischen Material geht dabei deutlich hervor, dass die Angeklagten zunächst auf die Nachsicht der Obrigkeit vertrauten und glaubten, «man werde wie früher durch die Finger sehen.» 134Diese stillschweigende Übereinkunft zwischen den Reisläufern, Werbern und Pensionenverteilern auf der einen Seite und Teilen der politischen Elite auf der anderen Seite fand mit den Aufständen allerdings ein abruptes Ende. Die im Verlauf der Unruhen wegen ihrer Pensionenbezüge massiv unter Druck geratenen Ratsherren inszenierten sich mit Blick auf die anstehenden Prozesse «als Opfer der arglistigen Täuschungsmanöver der französischen Gesandten», was zur Folge hatte, dass sie sich gegenseitig die Verantwortung zuschoben. 135Simon Teuscher erkannte 1998 in seiner Dissertation über die Soziabilität und Politik in der Stadt Bern um 1500 das heuristische Potenzial der Ereignisse im Umfeld des Könizer Aufstandes und machte das überlieferte Material erstmals für die historische Klientelismusforschung fruchtbar. 136Teuschers Zugang leitet über zu einigen methodischen Überlegungen und den der Untersuchung zugrunde liegenden Quellen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Geld, Krieg und Macht»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Geld, Krieg und Macht» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Geld, Krieg und Macht» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.