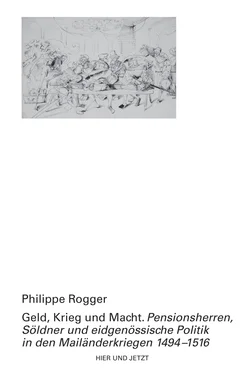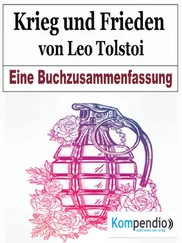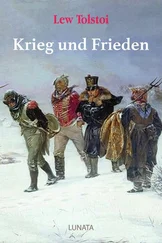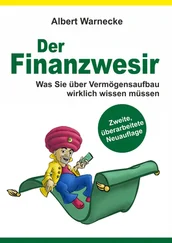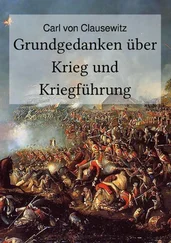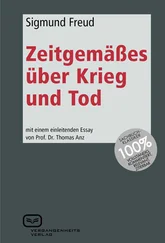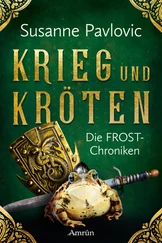Philippe Rogger - Geld, Krieg und Macht
Здесь есть возможность читать онлайн «Philippe Rogger - Geld, Krieg und Macht» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Geld, Krieg und Macht
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Geld, Krieg und Macht: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Geld, Krieg und Macht»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Geld, Krieg und Macht — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Geld, Krieg und Macht», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Inwieweit diese Gebilde politisch effizient 182und stabil waren, ist schwierig zu beurteilen. Der politische Output dieser Beeinflussungspraktiken steht denn auch nicht im Fokus der Untersuchung, da empirische und methodische Grundlagen für die Messbarkeit von Erfolg und Misserfolg fehlen. Grundsätzlich lässt sich jedoch festhalten, dass kein Automatismus zwischen Zahlung und Leistung (bzw. politischem Erfolg) bestand. Die Frage nach der Stabilität der Verflechtung hingegen wirft ein quellenkritisches Problem auf, das nicht ignoriert werden kann. Klientelistische Beziehungen waren zwar häufig von Dauer, 183dennoch handelte es sich bei solchen Netzwerken auch um prekäre, ephemere Gebilde. Insbesondere an deren äusseren Rändern handelte es sich, so scheint es, partiell um synaptische Verbindungen, die nur kurz aufblitzten und sich dann wieder auflösten. Denn auch einmalige Zahlungen (sogenannte «Schenkinen») an verschiedenste Empfänger gehörten zur diplomatischen Praxis der Gesandten, ohne dass dadurch eine dauerhafte Beziehung zwischen einem Patron und einem Klienten konstituiert worden wäre. Bei diesen Zahlungen scheint der Verdacht auf einfache Bestechung in der Tat gerechtfertigt zu sein. 184Mit Blick auf die Quellen erweist sich die Unterscheidung in der Praxis jedoch als schwierig bis unmöglich. Die in Kapitel III.2grafisch festgehaltenen Netzwerke von 1512/13 stellen aus diesen Gründen eine zeitlich begrenzte, gewissermassen fotografische Momentaufnahme dar, wobei insbesondere deren Kapillaren einem steten Wandel unterlagen. Ohnehin scheint eine messerscharfe Abgrenzung einfacher gesellschaftlicher Kommunikation vom Netzwerkbegriff nicht immer möglich. Der Netzwerkbegriff, der suggeriert, dass etwas Bestehendes lediglich sichtbar gemacht werden müsse, hat die Tendenz, die Nähe des Konzepts zur trivialen gesellschaftlichen Kommunikation zu kaschieren. 185Um beide Bereiche einigermassen sinnvoll voneinander unterscheiden zu können, ist der kontinuierliche Ressourcenaustausch zwischen Patron und Klient entscheidend. Dabei wirkte die Logik, dass Patron und Klient bezüglich des Leistungsaustauschs nie quitt waren, stabilisierend auf die Beziehung. 186
1 Streit um Mailand und gescheiterte Friedensgespräche – Vorgeschichte
Im letzten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts wurde Italien zum Ziel der expansiven Pläne Frankreichs und Spaniens. Beide Länder hatten in jener Epoche bereits ein hohes Mass an monarchischer Konzentration erreicht und strebten mit der Herrschaft über Italien die Verfügung über den Reichtum der Handelszentren und über die Agrarproduktion im Norden und in der Mitte Italiens an. Die Herrschaft über die Halbinsel versprach die Sicherung der Vormacht im Mittelmeer und war gleichzeitig der Schlüssel zur europäischen Hegemonie. 11494 war die Konsolidierung der französischen Monarchie im Innern so weit abgeschlossen, dass Karl VIII. einen Feldzug nach Neapel in Angriff nehmen konnte. Mit diesem Feldzug beabsichtigte er, die angiovinischen Ansprüche auf die Herrschaft des Hauses Anjou in Neapel mit militärischen Mitteln durchzusetzen. Der Gegensatz zwischen den Valois und Habsburg wurde nach dem Konflikt der beiden Häuser um das burgundische Erbe (1477–1493) nun auf der Apenninenhalbinsel fortgesetzt und brachte das fragile italienische Staatensystem in kurzer Zeit zum Einsturz. 2
Die Jahre zwischen dem Zug Karls VIII. nach Neapel 1494 und dem Sieg von König Franz I.in Marignano 1515 zeichnen sich durch zahlreiche militärische Kampagnen sowie eine ausserordentlich dynamische Koalitions- und Bündnispolitik der involvierten Machtblöcke aus. Bereits 1494 kam Frankreich neben der Überlegenheit seiner Artillerie und seiner schweren Kavallerie auch der Einsatz eidgenössischer Reisläufer zugute. 3Bis 1509 lieferten die Orte dem französischen König die begehrten Söldner. In den Jahren zwischen 1509 und 1511 kam es allerdings zu einer aussenpolitischen Neuausrichtung der eidgenössischen Orte. Diese wandten sich von Frankreich ab, worauf die 1509 abgelaufene Soldallianz von 1499 nicht mehr erneuert wurde. Es folgten ein Bündnisschluss mit dem Papst 1510 und 1511 der Abschluss der Erbeinung mit Maximilian I. 4Der 1512 aus eigenen machtpolitischen Antrieben unternommene Pavierzug führte zur Kapitulation Cremonas, Pavias und Mailands sowie der Vertreibung der Franzosen aus der Lombardei. Dadurch spitzte sich der Konflikt um den Zankapfel Mailand merklich zu. 5Am 29. Dezember 1512 setzten die Eidgenossen ohne Rücksicht auf die Interessen des Kaisers, den formellen Oberlehensherren Mailands, Massimiliano Sforza, Sohn Ludovico Sforzas, als mailändischen Herzog ein. 6Im Gegenzug verlangten die Eidgenossen und die Drei Bünde von Mailand Geldzahlungen und Gebietsabtretungen (Lugano, Locarno, Maggiatal, Domodossola, Veltlin, Drei Pleven). 7Der französische König Ludwig XII. zeigte sich allerdings keineswegs gewillt, den Verlust des Herzogtums, auf das er erbrechtliche Ansprüche geltend machte und das er immerhin seit der Eroberung im Jahr 1499 zu halten vermochte, hinzunehmen. 8Eine militärische Kampagne gegen die Eidgenossen kam für das unterlegene Frankreich zu jenem Zeitpunkt jedoch nicht infrage. Vielmehr wandte sich Ludwig auf diplomatischem Weg an seine Widersacher, um das reiche und verkehrspolitisch bedeutsame Südalpengebiet zurückzugewinnen. Er ersuchte bei den vom Papst zu Beschützern der Freiheit der Kirche erhobenen Eidgenossen um Friedensverhandlungen. Damit begann eine Phase erhöhter diplomatischer Geschäftigkeit in den einzelnen Orten und an den eidgenössischen Gesandtenkongressen. Seit Juli 1512 haben sich verschiedene Dynasten für eine Vermittlungstätigkeit zwischen der Eidgenossenschaft und dem französischen König anerboten. An einer solchen Annäherung konnte Papst Julius II., der grosse Gewinner des Sommers 1512, kein Interesse haben und mahnte die Eidgenossen eindringlich, nicht auf die Vermittlungsangebote Savoyens oder Lothringens einzugehen. 9Der Papst schien mit seinem Anliegen bei den Boten durchzudringen. Die angebotenen Dienste wurden zwar an den Tagsatzungen verhandelt, blieben jedoch folgenlos. Es gelang den Orten nicht, sich auf einen Bedingungskatalog für die Friedensgespräche zu einigen. Die eidgenössischen Boten traktandierten die Angelegenheit bis im Herbst desselben Jahres weiter, jedoch ohne realistische Aussicht auf Erfolg. 10Daraufhin nahm Frankreich mit den Eidgenossen direkt Kontakt auf und sandte seinen Marschall Gian Giacomo Trivulzio an die Tagsatzung, um dort für Frieden und Geleit zu werben. 11Tatsächlich zeichnete sich seit November eine Wende in der Haltung der Tagsatzung ab, die aber nicht einzig auf die Leistungen des geschickten Diplomaten und fähigen Militärs zurückzuführen sind. Zu diesem diplomatischen Erfolg beigetragen haben massgeblich auch die Aktivitäten der Prinzessin von Oranien. 12Unbesehen des lautstarken Protests des Papstes (bzw. seines Interessenvertreters Kardinal Matthäus Schiner) und dem Widerstand des besorgten Mailänder Herzogs stellte die Tagsatzung am 22. Dezember 1512 Frankreich die Zulassung einer Gesandtschaft in Aussicht und verfasste einen auf den 23. Dezember datierten Geleitbrief, der die Bedingungen für den Aufenthalt der Gesandtschaft festhielt. Die Tagsatzung verlangte die Räumung von Lauis (Lugano) und Luggaris (Locarno) und untersagte die Anwerbung von Reisläufern während des Aufenthalts der Gesandten. 13Wie ist diese diplomatische Wende der Eidgenossen zu erklären?
Den Darstellungen des Berner Chronisten Ludwig Schwinkhart zufolge hatten die Franzosen das Geleit mit Geld erkauft. Dieses «wardt ouch geteilt allen denen, die reyerer vnd regenten oder vo(e)gt warendt». 14Ausführlicher werden die Ereignisse in der Chronik Anshelms beschrieben. 15Philiberta von Luxemburg, Prinzessin von Oranien und Gemahlin von Johann von Châlon, habe Ende Juli ihren Hofmeister Simon de Courbouson 16in die Eidgenossenschaft geschickt, der, so Anshelm, «mit stillen worten und kronen so vil zu(o)wegen bracht» habe. 17In welchem Ausmass das Wirken Courbousons die Verhandlungen konkret beschleunigt hatte, ist schwierig abzuschätzen. Es ist durchaus denkbar, dass die ausgeteilten Gelder Bewegung in die stockenden Verhandlungen brachten. Jedenfalls erschien am 11. Februar 1513 die französische Gesandtschaft unter der Leitung des Feldherrn Louis de La Trémoille, Fürst von Talmont und Gouverneur von Burgund, vor den eidgenössischen Boten in Luzern. In seinem Gefolge befanden sich Claude de Seyssel, Bischof von Marseille, Imbert de Villeneuve, Präsident des Parlaments in Dijon, Gaucher de Dinteville, Bailli von Troyes, und Jean de Baissey, Gruyer von Burgund. 18
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Geld, Krieg und Macht»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Geld, Krieg und Macht» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Geld, Krieg und Macht» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.