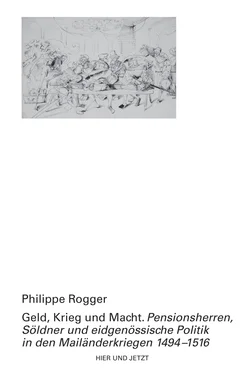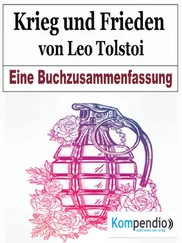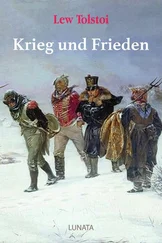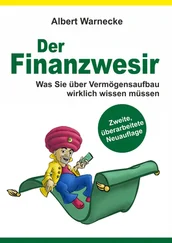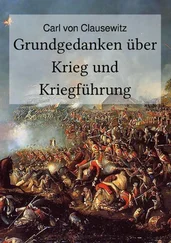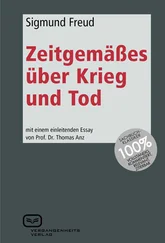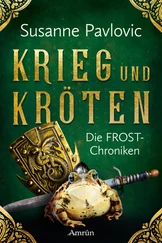Philippe Rogger - Geld, Krieg und Macht
Здесь есть возможность читать онлайн «Philippe Rogger - Geld, Krieg und Macht» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Geld, Krieg und Macht
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Geld, Krieg und Macht: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Geld, Krieg und Macht»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Geld, Krieg und Macht — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Geld, Krieg und Macht», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Ähnlich wie mit der Geschichte des Solddiensts verhält es sich mit der schweizerischen Historiografie zu den Pensionen. Mit dem Pensionenwesen, resümiert Groebner in einem kurzen Forschungsüberblick, haben sich die Historiker lange Zeit schwer getan. Operierte die Fachliteratur des beginnenden 20. Jahrhunderts bei der Pensionenfrage noch mit Metaphern wie «politische Entartung» oder «Volkskrankheit», fiel das Urteil erst in der Zwischenkriegszeit nüchterner aus. Das Pensionenwesen wurde zunehmend als Geschäft versachlicht und verkümmerte in der Nachkriegszeit zu einem peripheren Gegenstand der Geschichtswissenschaft. Der moralisierende Diskurs brach jedoch auch dann nicht vollständig ab. Noch 1974 spricht Emil Usteri in seiner Arbeit zur Schlacht von Marignano von einer «düsteren korrumpierten Zeit». 48Die Pensionen sind inzwischen jedoch zu einem wichtigen Thema der Finanzgeschichte, der Sozialgeschichte, der neueren Kulturgeschichte und der neueren Diplomatiegeschichte geworden. 49
Trotz dieser Neubeurteilung durch die neuere Forschung ist die Diskrepanz zwischen der Bedeutung des Sold- und Pensionenwesens für die ältere Schweizer Geschichte und der geringen Anzahl neuerer Publikationen augenfällig. Obschon sich verschiedene Sammelbände dem Thema angenommen haben, stellt eine aktuelle Überblicksdarstellung ein Desiderat der Forschung dar. 50Der profunde kurze Überblick Peyers über die fremden Dienste bleibt deshalb auch knapp zwanzig Jahre nach dessen Erscheinen unentbehrlich. Die dünne Forschungslage ist angesichts aktueller politischer Debatten schmerzlich. Beharrlich wird die Schweizer Geschichte im Umfeld der Schlacht von Marignano in den Diskussionen über das Verhältnis Schweiz-EU von Integrationsgegnern als Argument für eine aussenpolitische Abstinenz der Schweiz herangezogen. Die mehrteils ablehnende Haltung gegenüber den fremden Diensten ist eng verquickt mit dem von der Historiografie des 20. Jahrhunderts (Geistige Landesverteidigung) besonders plastisch inszenierten Bild des heldenhaften Hirtenkriegers des Mittelalters, der am Morgarten oder in Sempach einzig zum Schutz der Freiheit in den Schlachten gegen Habsburg seine adligen Gegner erzittern liess. Diese Vorstellung ist tief im eidgenössischen Selbstbild verankert und wird regelmässig an Gedenkfeiern medienwirksam zelebriert und aktualisiert. 51Die Niederlage von Marignano im Jahr 1515 hingegen – und mit ihr implizit auch die grenzübergreifende Verflechtung der eidgenössischen Machtelite – stellt im politischen Diskurs ein beliebtes historisches Lehrstück dar, um zu zeigen, dass Einmischungen in «fremde Händel» schlecht für die Schweiz sind. 52Die Niederlage von Marignano bedeutete jedoch keineswegs die Abkehr der Eidgenossen von der internationalen Politik – zumal sich Bern 1536 dazu anschickte, die Waadt zu erobern. Die Verflechtung der Orte mit fremden Mächten mittels Soldallianzen nahm ihren Anfang im 15. Jahrhundert und wurde nach der Niederlage in Marignano fortgesetzt und verstetigt. Mit Frankreich – dem militärischen Gegner in Marignano – schlossen die Orte 1516 den Ewigen Frieden und 1521 eine Soldallianz ab, die letztmals 1777 erneuert wurde. Weitere Soldallianzen der Orte, etwa mit Savoyen (1560, 1577), dem Papst (1565) oder Spanien (1587), kamen im Verlauf der frühen Neuzeit hinzu. Doch stehen die Instrumentalisierung Marignanos durch die Politik und die Persistenz schiefer Geschichtsbilder nicht im Interesse dieser Studie. 53Vielmehr lenken die seit 1474 mit verschiedenen Mächten abgeschlossenen Soldallianzen den Blick auf ein fundamentales Problem der älteren Schweizer Geschichte.
Gerade in einer Zeit, in der die Staaten ihr Monopol auf die militärische Gewaltanwendung in zahlreichen asymmetrischen Kriegen und wegen der zunehmenden Bedeutung von privaten Sicherheits- und Militärunternehmungen aufzugeben scheinen, gewinnt die Frage nach den historischen Wurzeln der herrschaftlich-staatlichen Kontrolle der militärischen Gewalt eine besondere Aktualität. 54
Von herausragender Bedeutung ist in diesem Zusammenhang eine veränderte Wahrnehmung des Verhältnisses von Militär, Gesellschaft und Politik. 55Vergegenwärtigt man die Hypothese von Otto Hintze aus dem Jahr 1906, dass alle Staatsverfassung ursprünglich Kriegs- beziehungsweise Heeresverfassung war, und die Tatsache, dass sich in der Organisationsform des Militärs auch die politische Verfasstheit eines Gemeinwesens spiegelt, so ist die Frage nach der Verfasstheit des Krieges auch aus einer historisch-wissenschaftlichen Perspektive eminent. 56Es war Peyer, der mit Nachdruck darauf hingewiesen hatte, dass sich auch in der alten Eidgenossenschaft Heeresform und Staatsform gegenseitig bedingten. Als sichtbare Merkmale dieser Reziprozität nennt Peyer den Verzicht einer kriegerischen Aussenpolitik, die territoriale und organisatorische Straffung der einzelnen Orte und die wachsende Trennung von Regierenden und Regierten sowohl im heimischen Militärwesen als auch im Solddienst bei fremden Mächten. 57Bis zur Reformationszeit kennzeichnete sich das eidgenössische Kriegswesen dadurch aus, folgt man Peyer weiter, dass der Krieg im Spätmittelalter sowohl staatlich-obrigkeitliche als auch «private» Impulse aufwies, wobei beide Aspekte häufig miteinander verwoben waren. 58Es bestand ein Spannungsfeld zwischen Fehde, unstaatlichem, privatem, brauchtümlich geregeltem und staatlich-obrigkeitlichem, durch gesetztes Recht zunehmend geordnetem Krieg. Indessen war die Durchsetzung des staatlichen Krieges laut Peyer nicht denkbar ohne den unstaatlichen Krieg. «Am einen konnte sich, am anderen musste sich jeder kampftüchtige Mann beteiligen. Beides verschaffte auch den breiten Bevölkerungsschichten und vor allem den bäuerlichen Untertanen ein ungewöhnliches Gewicht in den werdenden Staatsgebilden der Orte und zwang die Obrigkeiten zu entsprechender Rücksichtnahme. Die Stärkung der Obrigkeit seit dem 16. Jahrhundert aber sollte nur dank Veränderungen im Kriegswesen möglich werden.» 59Entscheidend in diesem Zusammenhang waren laut Peyer unter anderem die Anstrengungen der Obrigkeit um 1500, den mittlerweile zum Massenphänomen avancierten Solddienst zu kontrollieren. Die Orte zeigten sich bemüht, «ihre in fremde Dienste ziehenden Truppen nicht völlig aus der Hand zu geben, ja geradezu staatliche Hoheitsrechte über sie auszuüben.» 60Die Organisation der fremden Dienste berührt somit die zentrale Frage nach dem staatlichen Gewaltmonopol. Es lag im genuinen Interesse der Obrigkeit, das Tun «privater» Gewaltanbieter zu kontrollieren und in Übereinstimmung mit den obrigkeitlichen Interessen zu bringen, weil der unkontrollierte Söldnerexport ein erhebliches Risiko für die innere Stabilität sowie für die innere und äussere Sicherheit der Orte darstellte. 61Um dieses Geschäft zu kontrollieren, erliess die Obrigkeit Verbote in der Absicht, den freien Reislauf zu unterbinden, den unkontrollierten Wegzug von Arbeitskräften zu verhindern und ihre eigenen Einkünfte als Solddienstvermittler (Pensionen, Sold) zu sichern. Die Versuche der Obrigkeit, den Reislauf zu kanalisieren und unter ihre Kontrolle zu bringen, erwiesen sich jedoch grösstenteils als illusorisch, profitierten doch einflussreiche Familien aus den städtischen Räten selbst in hohem Mass von der starken Nachfrage der Grossmächte nach Söldnern. Bezahlte Kriegsdienste und Aussenbeziehungen wurden um 1500 zunehmend zum Handlungsfeld von multipel vernetzten Militärunternehmern und Geschäftsmännern, die gleichzeitig in den Räten sassen. Sie nutzten die Pensionen, Soldgelder und anderen Ressourcen, die sie als Gegenleistungen für ihre politischen und militärischen Dienste von fremden Mächten erhielten, für den Auf- und Ausbau ihrer Macht. Die obrigkeitliche Sold- und Pensionenpolitik (Verbote) wurde von diesen Kreisen systematisch ignoriert. Sie hatten keinerlei Interesse an einer Einschränkung des Sold- und Pensionenwesens. Freilich stiessen die grenzübergreifenden Ressourcentransfers und Patronagepraktiken bei Teilen der Machtelite und bei Teilen der Untertanen auf Ablehnung. Die Gründe dafür sind vielfältig.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Geld, Krieg und Macht»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Geld, Krieg und Macht» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Geld, Krieg und Macht» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.