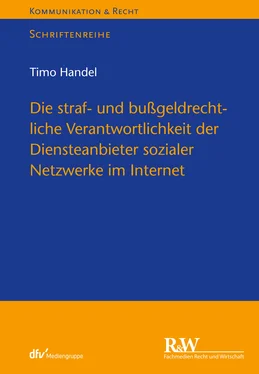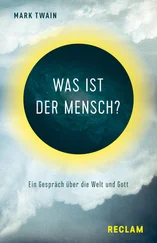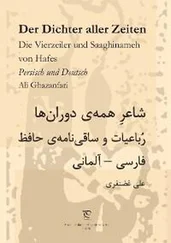1. die Speicherung oder Verwendung der weit überwiegenden Zahl der gespeicherten Informationen rechtswidrig erfolgt,
2. der Diensteanbieter durch eigene Maßnahmen vorsätzlich die Gefahr einer rechtsverletzenden Nutzung fördert,
3. in vom Diensteanbieter veranlassten Werbeauftritten mit der Nichtverfolgbarkeit bei Rechtsverstößen geworben wird oder
4. keine Möglichkeit besteht, rechtswidrige Inhalte durch den Berechtigten entfernen zu lassen.“
Nach Stellungnahme des Bundesrates, wonach „die Vermutungsregelung in § 10 Abs. 2 des Regierungsentwurfs“ aufgrund „zu erwartenden negativen Auswirkungen auf Medienvielfalt und Meinungsfreiheit abzulehnen“ ist, hat die Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung zugesagt, das Anliegen eingehend zu prüfen.362 Im weiteren Gesetzgebungsverfahren wurde die Änderung des § 10 TMG aus der Beschlussvorlage des Regierungsentwurfs entfernt und die Norm in der Folge nicht mehr geändert.363
Eine Ergänzung der Haftungsregelungen erfolgte jedoch in § 8 TMG. Der neu angefügte Abs. 3 regelt, dass § 8 Abs. 1 und 2 TMG auch für Diensteanbieter nach § 8 Abs. 1 TMG gelten, die ihren Nutzern einen Internetzugang über ein drahtloses lokales Netzwerk zur Verfügung stellen. Ziel dieser Änderung und der mit dem dritten Gesetz zur Änderung des Telemediengesetzes vorgenommenen weiteren Änderungen der §§ 7 und 8 TMG ist die Schaffung von mehr Rechtssicherheit für die Betreiber von öffentlichen WLAN-Hotspots.364
342BT-Drucks. 13/7385, S. 1. 343Vgl. die gemeinsame Erklärung von Bund und Ländern vom 18.12.2006, abgedruckt bei Engel-Flechsig, ZUM 1997, 231. 344Der Bund war der Ansicht, dass das Internet dem Telekommunikationsbereich zuzuordnen sei und ihm daher die Kompetenz zur Gesetzgebung zustehe. Dies bestritten die Länder, die der Auffassung waren, dass es sich um Rundfunk oder rundfunkähnliche Dienste handele, welche in ihre Gesetzgebungskompetenz fallen (siehe Hoeren, NJW 2007, 801; Spindler, CR 2005, 741, 745). 345Hoeren, NJW 2007, 801, 802. 346Zur damals erforderlichen Abgrenzung von Telediensten und Mediendiensten siehe auch Engels, K&R 2001, 338, 340. 347BT-Drucks. 14/6098, S. 1. 348Heckmann, in: Heckmann, jurisPK-Internetrecht, Kap. 1 Rn. 16. 349Tettenborn, K&R 1999, 252, 258; Spindler, CR 2005, 741, 745. 350Sieber/Liesching, MMR-Beilage 8/2007, S. 3f. 351Tettenborn, K&R 1999, 252, 253. 352Jandt, in: Roßnagel, Recht der Telemediendienste, TMG § 7 Rn. 16; Nickels, CR 2002, 302, 305; Frey/Rudolph/Oster, CR Beilage zu Heft 11/2015, S. 2; Spindler, ZUM 2017, 473, 478; Spindler, in: Spindler/Schmitz, Telemediengesetz, TMG Vor § 7 Rn. 13. 353BGBl. 2001 I, S. 3721; BT-Drucks. 14/6098, S. 1. 354Spindler, CR 2005, 741, 745. 355BGBl. 2007 I, S. 179; BT-Drucks. 16/3078, S. 1ff. 356Hoeren, NJW 2007, 801. 357Siehe auch Kapitel 3 B. II. 358WLAN steht für Wireless Local Area Network. 359BT-Drucks. 18/6745, S. 1. 360BT-Drucks. 18/6745, S. 1. 361BT-Drucks. 18/6745, S. 6. 362BT-Drucks. 18/6745, S. 15 und 17. 363BT-Drucks. 18/8645, S. 11. 364BT-Drucks. 18/12202, S. 9.
C. Anwendbarkeit des TMG auf die Diensteanbieter sozialer Netzwerke
Zur Beantwortung der Frage, ob Diensteanbieter sozialer Netzwerke nach einer oder mehrerer der vorgenannten Regelungen in ihrer Haftung privilegiert sein könnten, müssten diese und damit das TMG zunächst überhaupt Anwendung auf sie finden. Gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 TMG gilt das TMG für Telemedien. Wie bereits dargestellt, sind soziale Netzwerke im Internet als Telemedien im Sinne der Legaldefinition des TMG zu qualifizieren.365 Das TMG ist daher auf die Diensteanbieter sozialer Netzwerke anwendbar.
365Siehe hierzu Kapitel 1 A. I. 2. b.
D. Der Begriff der „Verantwortlichkeit“
Das Haftungsregime der §§ 7 bis 10 TMG regelt die „Verantwortlichkeit“ der Diensteanbieter (vgl. die Überschrift des dritten Abschnitts des TMG und den Wortlaut der Regelungen), indem es verschiedene Haftungsprivilegierungen vorsieht. Trotz dessen findet sich im TMG keine Legaldefinition des Begriffs.
Nach allgemeinem juristischem Sprachgebrauch bedeutet der Begriff Verantwortlichkeit ein Einstehenmüssen für etwas,366 insb. „für die Rechtsfolgen, die das Recht an bestimmte Sachverhalte knüpft“,367 wobei es sich um einen rechtsgebietsübergreifenden Begriff handelt.368 Die Gesetzesbegründung definiert dementsprechend die Verantwortlichkeit als „das Einstehenmüssen für eigenes Verschulden“.369 Demgegenüber wird auch eine weitergehende Auslegung vertreten, welche die Verantwortlichkeit auf ein „Einstehenmüssen für jedes Verhalten, das einen Haftungsanspruch auslöst“, also auch auf eine verschuldensunabhängige Haftung, erweitert.370 Die Verantwortlichkeit ist demnach ein Einstehenmüssen für jegliche Rechtsverletzungen.371 Für das Strafrecht ist diese Erweiterung jedoch unerheblich, da eine Bestrafung stets Schuld voraussetzt.
366Bleisteiner, Rechtliche Verantwortlichkeit im Internet, S. 158. 367Ritz, Inhalteverantwortlichkeit von Online-Diensten, S. 69, zu § 5 TDG 1997. 368Altenhain, in: MüKo StGB, TMG Vor § 7 Rn. 3; Heß, Die Verantwortlichkeit von Diensteanbietern, S. 33. 369BT-Drucks. 13/7385, S. 19. 370Jandt, in: Roßnagel, Recht der Telemediendienste, TMG § 7 Rn. 24; Spindler, in: Spindler/Schmitz, Telemediengesetz, TMG Vor § 7 Rn. 20; vgl. auch Hoffmann/Volkmann, in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, TMG Vor § 7 TMG Rn. 24. 371Vgl. Rath, AfP 2005, 324.
E. Anwendbarkeit der Haftungsprivilegierungen im Strafrecht
Im Hinblick auf Erwägungsgrund 8 der ECRL stellt sich die Frage, ob die verantwortlichkeitsregelnden Haftungsprivilegierungen der §§ 8ff. TMG auch im Strafrecht Anwendung finden, da mit der ECRL der Bereich des Strafrechts als solcher nicht harmonisiert werden soll.
Trotz dessen ist die Anwendbarkeit der Haftungsprivilegierungen im Strafrecht mit der allgemeinen Meinung zu bejahen.372 Denn der Gesetzgeber wollte zum einen die Haftung der Diensteanbieter rechtsgebietsübergreifend und gerade auch im Strafrecht einschränken.373 Zum anderen bezwecken die Art. 12ff. ECRL eine umfassende Privilegierung, in deren Rahmen die strafrechtliche Privilegierung zumindest eine erwünschte Nebenfolge darstellt.374 Dem steht Erwägungsgrund 8 der ECRL nicht entgegen.375 Aus dessen Formulierung „als solchen“ folgt allein, dass mit der ECRL keine speziellen Regelungen für das Strafrecht geschaffen werden sollen.376 Es handelt sich daher lediglich um einen klarstellenden Hinweis.377
Zudem folgt aus Erwägungsgrund 26 der ECRL, dass die Mitgliedstaaten ihre nationalen strafrechtlichen Vorschriften und Strafprozessvorschriften nur im Einklang mit den in der ECRL festgelegten Bedingungen anwenden können. Aus der Formulierung „im Einklang“ ist zu folgern, dass die Haftungsregelungen der ECRL zwingend zu berücksichtigen sind und damit nach den europäischen Vorgaben auch im Strafrecht Anwendung finden. Demgegenüber vertritt Busse-Muskala , dass die Umsetzung der Haftungsprivilegierungen der ECRL über die Vorgaben der Richtlinie hinausgehen und – „aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht prinzipiell unbedenklich“ – auch das Strafrecht erfassen, obwohl dies zur Richtlinienumsetzung gar nicht geboten wäre.378
Eine Nichtanwendung der Vorschriften im Strafrecht würde zudem zu eklatanten Widersprüchen und „abstrusen Konsequenzen“ führen, da mit dieser im Bereich des Strafrechts eine faktische Kontrollpflicht bestehen würde, die zivilrechtlich durch § 7 Abs. 2 TMG ausgeschlossen ist.379
Die Geltung der Haftungsprivilegierungen für alle Rechtsgebiete, also auch das Strafrecht, ergibt sich letztlich auch aus dem Begriff der „Verantwortlichkeit“, der – wie bereits gezeigt380 – eine Rechtsgebietsübergreifende Formulierung darstellt und als Oberbegriff der „rechtsgebietsspezifischen Begriffe ‚strafbar‘ oder ‚haftet‘ gewählt wurde“ und damit „jede Art des rechtlichen Einstehenmüssens“ erfasst.381
Читать дальше