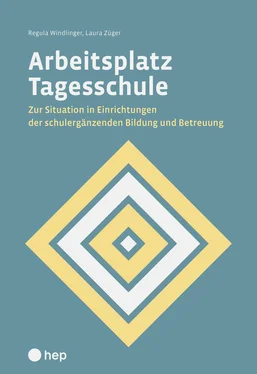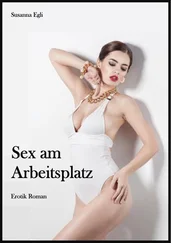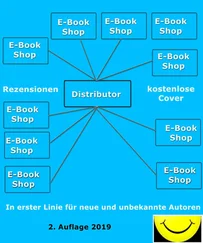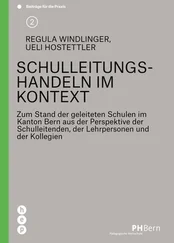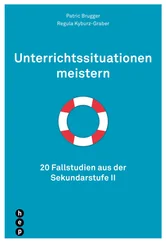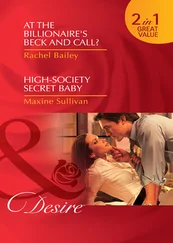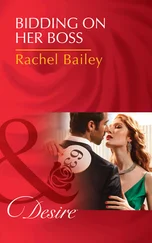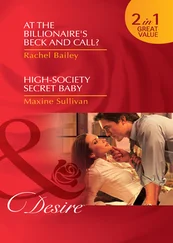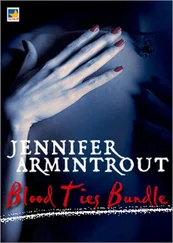Im Kanton Solothurn gilt derselbe Anteil an pädagogischem Personal wie im Kanton Bern. Zudem führt der Kanton Solothurn eine Liste mit Ausbildungen, die zu dem anerkannten Fachpersonal zählen (ASO, 2015). Der Kanton Solothurn empfiehlt den Einrichtungen ein Personalreglement. Es soll die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitenden sowie die Besoldung regeln (ASO, 2016). Weiter empfiehlt der Kanton Solothurn das Erstellen von Stellenbeschrieben.
Auch die Verbände gehen von einem Anteil von mindestens der Hälfte pädagogischem Fachpersonal aus (Bildung und Betreuung, 2010; Kibesuisse, 2017). Zudem heben die Autorinnen der Gesundheitsstiftung Radix (Conrad Zschaber et al., 2018) die Bedeutung von Personalentwicklung im Sinne von guten Aus- und Weiterbildungen hervor, die die Kompetenzen sichern und zur Motivation und Zufriedenheit des Personals beitragen sollen. Im Idealfall sind die Weiterbildungen mit der Schule und anderen Institutionen koordiniert (Bildung und Betreuung, 2010) und die Rahmenbedingungen in einem Weiterbildungsreglement festgehalten (Kibesuisse, 2018a).
Die Gewerkschaft vpod geht weiter und fordert ausschliesslich pädagogisch ausgebildetes Personal in Betreuungseinrichtungen. Sie empfiehlt zum Thema Personalentwicklung, dass alle Angestellten mindestens fünf Tage bezahlten Weiterbildungsurlaub pro Jahr beziehen können sollten (vpod, 2012).
Bezüglich der Anstellungsbedingungen des Personals empfiehlt vpod, dass 20 Prozent der Arbeitszeit als «mittelbare Arbeitszeit» veranschlagt werden soll. Damit sind kinderfreie Zeiten gemeint, die Vor- und Nachbereitung, Austausch im Team und mit der Schule, Elterngespräche, Supervision, Administration und Ähnliches beinhalten (ebd.). Um eine möglichst grosse Kontinuität beim Personal gewährleisten zu können, aber auch um die «anspruchsvolle Aufgabe mit grosser Verantwortung und einem sozialen und präventiven Charakter» professionell wahrzunehmen, sind faire und zeitgemässe Löhne und Anstellungsbedingungen notwendig (Kibesuisse, 2018a, S. 1). Deshalb fordert vpod (2012) eine Anstellung des Personals in schulergänzenden Einrichtungen über den Kanton oder die Gemeinden. Auch sollen die Löhne der Betreuungspersonen «in einem begründeten Verhältnis zu den Löhnen der Lehrpersonen stehen. Der formale Unterschied zwischen Lehrpersonen und tertiär ausgebildeten Betreuungspersonen sollte höchstens eine Stufe im Lohnsystem betragen» (ebd., S. 12). Der Verband Bildung und Betreuung (2010) unterstützt diese Forderung. Das Personal soll nach einem offiziellen Reglement des Kantons oder der Gemeinde angestellt werden oder die Arbeitsverträge sollen einem Gesamtarbeitsvertrag unterliegen. Der Verband Kibesuisse hat Lohnempfehlungen in einer Publikation festgehalten, wonach «erfolgreich absolvierte und anerkannte branchenspezifische Aus- und Weiterbildungen […] bei der Lohneinstufung zu berücksichtigen» sind (Kibesuisse, 2018a, S. 12).
Die Kantone Bern und Solothurn haben ähnliche Richtlinien bezüglich des Betreuungsschlüssels. Beide gehen von mindestens einer anerkannten Fachperson aus, die stets anwesend sein muss. Der Kanton Bern geht von mindestens einer Betreuungsperson pro zehn Schulkinder aus (TSV, Art. 5, 2008), der Kanton Solothurn von einer Betreuungsperson pro sieben Plätze, wobei sie eine Gewichtung der Plätze je nach Alter vornehmen. Bei Kindern ab der 3. Klasse ist im Kanton Solothurn ein Betreuungsschlüssel von mindestens 1:14 vorgesehen, bei jüngeren Kindern ist der Betreuungsschlüssel entsprechend tiefer, das heisst eine Betreuungsperson betreut weniger Kinder (ASO, 2015). Der Kanton Aargau macht keine Angaben zum Betreuungsschlüssel, da die Gemeinden diesen in ihren Qualitätsstandards selbst festlegen können.
Von Fachstellen werden verschiedene Betreuungsschlüssel empfohlen, ihnen liegen unterschiedliche Berechnungsschemata zugrunde. Als Minimalstandard empfiehlt Kibesuisse (2017) eine anerkannte Fachperson pro 14 Schulkinder, zusätzlich sollen Lernende oder Assistenzpersonal zur Verfügung stehen. Dasselbe empfiehlt die Fachstelle Kinder&Familien (2017), bei Kindergartenkindern soll sich der Betreuungsschlüssel auf 1:12 Kinder senken. Der Verband Bildung und Betreuung empfiehlt einen Durchschnitt von 7–8 Kindern pro erwachsene Person (Bildung und Betreuung, 2010). Zusätzliche Funktionen des Personals sollen im Stellenplan berücksichtigt werden, wozu Kibesuisse (2018a) Empfehlungen abgibt.
Während der Betreuungsschlüssel das Verhältnis der Anzahl Betreuungspersonen zur Anzahl Schülerinnen und Schüler definiert, bezeichnet die Gruppengrösse die maximale Anzahl von Schülerinnen und Schülern pro Gruppe in der Einrichtung (unabhängig von der Anzahl Betreuungspersonen). Die Gemeinden im Kanton Aargau sollen die Gruppengrösse in den Qualitätsstandards selbst festlegen. Der Kanton Solothurn bezieht sich auf die Pflegekindverordnung des Bundes (PAVO, 1977). Der Kanton Bern macht dazu keine Angaben.
Aus pädagogischer Sicht empfiehlt der Verband Kibesuisse (2017) eine Gruppengrösse, die sich an der Innendifferenzierung, also am Alter der Kinder, an den Räumlichkeiten und auch am Ausbildungsstand des Betreuungspersonals orientiert.
2.6 Räumlichkeiten und Standort
Die Gemeinden im Kanton Aargau müssen die Mindestanforderungen an den Raum und den Standort in ihren Qualitätsstandards festlegen. Der Kanton Bern schreibt unter anderem einen geeigneten und bedarfsgerechten Standort und mindestens zwei Räume vor (TSV, Art. 6, 2008). Es besteht die Empfehlung, dass sich die Tagesschule möglichst nahe oder gar in der Schule selbst befindet, damit sie die Infrastruktur gemeinsam nutzen können. Zudem empfiehlt die Erziehungsdirektion einen Raumanteil von 4 m 2pro Kind und einen Raum für Gespräche und/oder für die Leitung. Auch sollen eine Turnhalle sowie ein Aussenraum zur Verfügung stehen, die durch die Kinder selbst erreichbar sind (ERZ, 2009). Der Kanton Solothurn empfiehlt, dass pro Kind mindestens 5 bis 6 m 2reine Spielfläche im Innenraum, verteilt auf mindestens zwei Räume, zur Verfügung stehen. Die Ausstattung soll altersgerecht sowie entwicklungsfördernd sein und die Bedürfnisse der Kinder nach Aktivität und Ruhe decken (ASO, 2015).
Die Verbände empfehlen, die Einrichtungen der SEBB möglichst in der Schulanlage anzusiedeln, ansonsten in kurzer Fussdistanz davon entfernt (K&F, 2017; Kibesuisse, 2017). Der Raumbedarf entspricht einer pädagogisch nutzbaren Fläche von 5 bis 6 m 2pro Kind (Bildung und Betreuung, 2010; K&F, 2017; Kibesuisse, 2017). Es sollen mindestens zwei Räume zur Verfügung stehen (Bildung und Betreuung, 2010). Die Ausstattung sollte der Köpergrösse der Kinder angepasst sein sowie sicher, zweckdienlich und pflegeleicht sein (ebd.; Kibesuisse, 2017). Die Fachstelle Kinder&Familien (2017) empfiehlt eine Ausgestaltung, die sich an den Faktoren Bewegung, Rückzugsorte und Nischen, kreatives Spiel, Erleben, Beobachten und Entdecken sowie Begegnung orientiert. Zudem sollen die Kinder an der Gestaltung der Räume beteiligt werden (Bildung und Betreuung, 2010). Für das Personal sollte ein Raum zur Verfügung stehen, der für Pausen, aber auch für Gespräche genutzt werden kann (ebd.).
2.7 Angebot und Öffnungszeiten
Der Kanton Aargau stützt sich bezüglich der Einrichtungstypen auf die Typologie des Bundesamts für Statistik BFS (2015), wobei für unser Forschungsprojekt die Typen modulare Tagesstrukturen für Schulkinder, gebundene Tagesstrukturen für Schulkinder und Tagesstrukturen für alle Altersstufen relevant sind (Departement Gesundheit und Soziales des Kantons Aargau, 2016).
Im Kanton Bern werden Ferienbetreuungsangebote für Tagesschulen empfohlen: «Gemeinden können sich an der Idee orientieren, dass ihre Tagesschule immer geöffnet hat – auch während der Schulferien» (ERZ, 2018b, S. 5). Als Tagesschulangebote werden die Frühbetreuung, die Mittagsbetreuung mit Verpflegung, die Aufgabenbetreuung und die Nachmittagsbetreuung aufgelistet (ERZ, 2009). Ein Tagesschulangebot besteht je nach Bedarf aus einzelnen oder allen Modulen.
Читать дальше