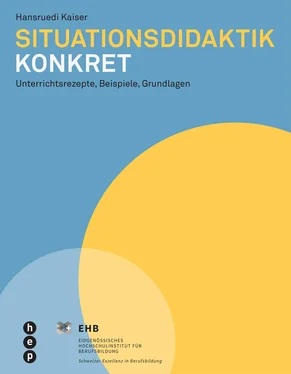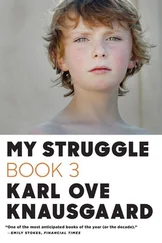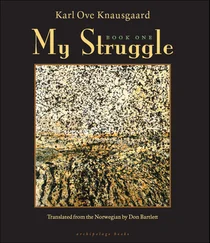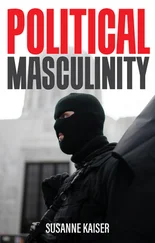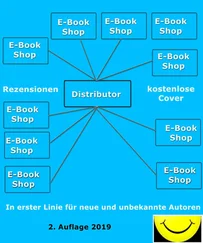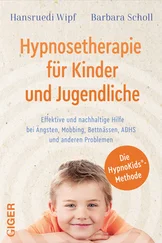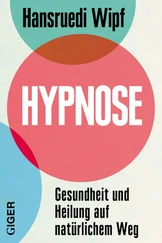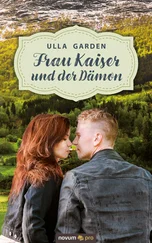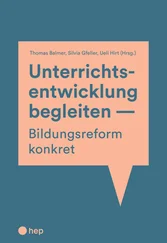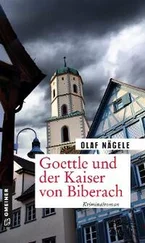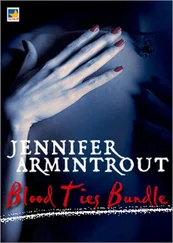Kritische Reflexion :Dies ist dann nochmals der Moment, die Möglichkeiten und Grenzen des behandelten Vorgehens kritisch zu diskutieren, seine Stärken und Schwächen festzuhalten. Oft ergibt sich das von selbst, wenn einzelne Lernende davon berichten, dass in ihrem Betrieb anders vorgegangen wird oder dass das an der Schule behandelte Vorgehen dort explizit abgelehnt wird.
Erfahrungen reflektieren :Wenn man sich besonders intensiv mit einer Erfahrung, die die Lernenden aus dem Betreib zurückbringen, auseinandersetzen will, kann man das mithilfe von A2 Erfahrungen reflektieren machen.
Cattaneo, A. & Felder, J. (2018). Eine digitale Brücke zwischen den Lernorten. skilled, 1/18.
A2 ERFAHRUNGEN REFLEKTIEREN
Zweites Grundrezept: «Reflektierende Fallstudie»
Die Lernenden machen im Betrieb täglich neue Erfahrungen in unterschiedlichsten Situationen wie «Brot backen», «ein Kundengespräch führen», «eine Klientin mobilisieren», «ein Gerüst aufstellen», «einen Computer als Server einrichten» etc. Diese Erfahrungen werden in Zukunft ihr Handeln leiten (Hintergrund: C1 Subjektive Erfahrungsbereiche) . Daher ist es wichtig, sie zu reflektieren. Professionelles Handeln ist nur möglich, wenn sich die Lernenden bewusst sind, welche ihrer Erfahrungen positive Modelle abgeben, die man getrost kopieren kann (z.B. beim Gerüstbau einen Helm tragen), und welche eher negative Beispiele sind, die man meiden sollte (z.B. schnell, schnell und ungesichert am Gerüst noch eine Veränderung vornehmen).
Für viele Situationen gibt es Regeln oder Leitlinien wie «Hygieneregeln», «Sicherheitsregeln auf dem Bau», «Grundsätze eines erfolgreichen Kundengesprächs» oder «ergonomisches Arbeiten». All diese Leitlinien eignen sich, um Erfahrungen kritisch zu reflektieren, haben aber meist nicht die Form eines Verfahrens, das man erlernen könnte. Aus den «Grundsätzen eines erfolgreichen Kundengesprächs» lässt sich beispielsweise nicht direkt ableiten, was man in einem bestimmten Moment genau sagen soll. Die «Grundsätze» eignen sich aber hervorragend, um nachher darüber nachzudenken, ob das, was man im Verlauf eines bestimmten Gespräches gesagt hat, sinnvoll war (positives Modell) oder eher nicht (negatives Modell) (Hintergrund: C7 Schnelles Denken, langsames Denken) .
Um den Lernenden zu helfen, ihre Erfahrungen in diesem Sinne zu reflektieren, entstand das Unterrichtsrezept Erfahrungen reflektieren .
Leseanleitung:Möchten Sie sich einfach informieren, wie dieses Rezept aufgebaut ist, dann lesen Sie hier direkt weiter. Möchten Sie aber angeleitet werden, wie Sie sich dieses didaktische Rezept am besten zu eigen machen, dann gehen Sie zu A9 Leseanleitung zu Teil A .
A2.2 Erfahrungen reflektieren kurz gefasst
Das Rezept umfasst acht Schritte, die aufeinander aufbauen. Im Zentrum stehen:
• Eine bestimmte Situation– wie «Brot backen» oder «einen Computer als Server einrichten» –, welche die Lernenden im beruflichen Alltag immer wieder antreffen und zu der sie entsprechend schon verschiedene Erfahrungen gesammelt haben.
• Ein bewährtes Raster(Regel oder Leitlinie), mit dessen Hilfe man diese Erfahrungen als positive oder negative Modelle einstufen kann.
Schritt 1: Vorgabe einer typischen beruflichen Handlungssituation
Die Lehrperson bestimmt eine typische berufliche Handlungssituation, die im Fokus stehen soll (z.B. «Reklamationen von Kunden entgegennehmen»). Dies muss eine Situation sein, welche die Lernenden bereits erlebt haben.
Schritt 2: Geschichte wählen und erzählen
Vorschlagen: Die Lernenden machen Vorschläge zu Geschichten, die sie über Erlebnisse in der betreffenden Situation erzählen können (z.B. «eine anspruchsvolle Kundin», «ein wütender Kunde», «eine verwirrte Kundin»).
Auswählen: Alle (Lernende und Lehrperson) stimmen darüber ab, welche der vorgeschlagenen Geschichten vertieft behandelt werden soll (z.B. «ein wütender Kunde»).
Erzählen und Nachfragen: Die Lernende, die die gewählte Geschichte vorgeschlagen hat, stellt diese ausführlich dar (z.B. «Der Kunde war zuerst ganz höflich, aber dann …»). Die anderen fragen nach, wenn ihnen Dinge unklar sind oder wenn sie gern weitere Informationen hätten.
Schritt 3: Frage wählen
Fragen vorschlagen: Alle machen Vorschläge, welche Fragen sie gern anhand der erzählten Geschichte behandeln würden (z.B. «Was mache ich, wenn es zu einer Schlägerei kommt?» oder «Wie kann so etwas überhaupt passieren?»).
Fragen wählen: Alle stimmen darüber ab, welche Frage vertieft behandelt werden soll (z.B. «Wie kann so etwas überhaupt passieren?»).
Schritt 4: Raster wählen und darstellen
Wahl eines Rasters: Es wird ein Raster (ein theoretisches Konzept, ein Modell, eine Theorie) bestimmt, anhand dessen sich die gewählte Frage im Rahmen der Geschichte behandeln lässt (z.B. das Konzept des Vier-Ohren-Modells von Schulz von Thun).
Präsentation des Rasters: Eine Person beschreibt das Raster, sodass es allen präsent ist.
Schritt 5: Beschreibung
Die Geschichte wird in das Raster «eingefüllt», das heisst mithilfe der Begrifflichkeit des Rasters geordnet (z.B. Aspekte einzelner Äusserungen im Gespräch mit dem verärgerten Kunden den entsprechenden «Ohren»).
Schritt 6: Analyse
Anschliessend wird geklärt, ob das, was in der Geschichte geschehen ist, aus der Sicht des Rasters sinnvoll beziehungsweise korrekt war (z.B. «Wurde ein ‹Ohr› systematisch vernachlässigt?»).
Schritt 7: Varianten
Dieser Schritt schafft einen Freiraum, um Aspekte der Geschichte zu behandeln, die durch die vorangegangene fokussierte Analyse nicht berücksichtigt wurden. Er kann verschiedene Formen annehmen, wie beispielsweise:
Diskussionen, Input: Alle beteiligen sich an einer Diskussion, wie man beispielsweise in der Geschichte auch noch hätte vorgehen können (z.B. «Und was mache ich jetzt wirklich bei einer Schlägerei?»).
Übungen: Ausgewählte Aspekte des Rasters und seiner Anwendung werden gezielt geübt, etwa in Form von Rollenspielen (z.B. «auf Widersprüche zwischen den ‹Ohren› achten»).
Schritte 8: Konsequenzen
Individuell planen: Die Lernenden ziehen je für sich Konsequenzen aus dem Behandelten (z.B. das benutze Raster nochmals genauer durcharbeiten, in Zukunft im Betrieb anders zu reagieren …).
Schlussrunde: Die Lernenden beschreiben reihum kurz, welches ihre persönlichen Konsequenzen sind.
ERFAHRUNGEN REFLEKTIEREN IM ÜBERBLICK
1. Vorgabe einer typischen beruflichen Handlungssituation
2. Geschichte erzählen
3. Frage wählen
4. Raster wählen
5. Beschreibung
6. Analyse
7. Varianten
8. Konsequenzen
A2.3 Anregungen zu den einzelnen Schritten
So weit das Rezept Erfahrungen reflektieren einmal im Schnelldurchgang und anhand eines einfachen Beispiels (weitere Beispiele: B4 Reklamationsgespräch, B5 Das gute Leben und B6 Unterrichtsbeispiele besprechen) . Damit die einzelnen Schritte die gewünschte Funktion übernehmen und als Ganzes ineinandergreifen, gibt es Verschiedenes zu beachten.
Zu Schritt 1: Vorgabe einer typischen beruflichen Handlungssituation
Hintergrund: C1 Subjektive Erfahrungsbereiche; C7 Schnelles Denken, langsames Denken
Читать дальше