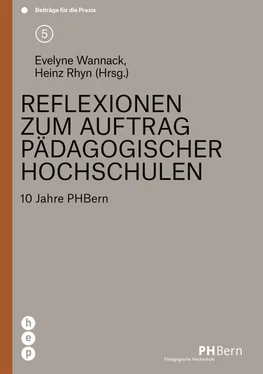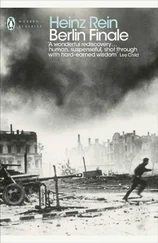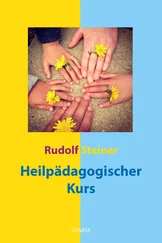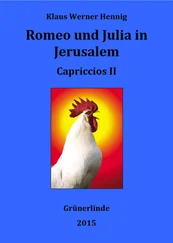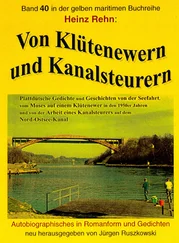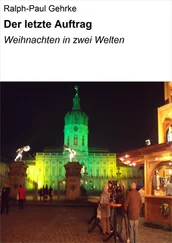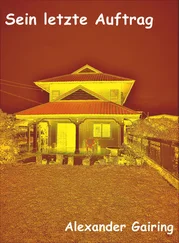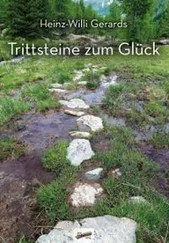Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte allerdings eine lange Phase großen Personalmangels in den Schulen begonnen, der sich im Zuge des anhaltenden Wirtschaftswachstums in den 1960er-Jahren stark zuspitzte (Criblez 2016/im Druck). Um mehr Lehrerinnen und Lehrer auf allen Schulstufen ausbilden zu können, wurde eine ganze Reihe von Maßnahmen realisiert – etwa die Neugründung von dezentralen Seminaren für Primarlehrerinnen und Primarlehrer in Langenthal (1963), Biel (1963) und Spiez (1972) oder die Eröffnung von Kindergärtnerinnenseminaren in Spiez und Biel (1971). Eine andere Maßnahme ist für das Verständnis des Strukturwandels aber bedeutsamer: Bereits 1948 fanden im städtischen Lehrerinnenseminar Marzili erstmals einjährige Sonderkurse – auch «Schnellbleichen» genannt – zur Erlangung des Lehrdiploms für Maturandinnen statt (Criblez 2016/im Druck). Jungen Frauen wurde großes Potenzial für den Lehrberuf zugesprochen, später wurde die stärkere Förderung von Mädchen und jungen Frauen in der höheren Bildung generell als wichtige Maßnahme gegen den allgemeinen Nachwuchsmangel angesehen (Criblez 2001). Zudem begann 1953 am Oberseminar in Bern der erste zweijährige «Umschulungskurs» für Berufsleute. Diese Kurse wurden anschließend bis in die 1970er-Jahre an verschiedenen Lehrerbildungsinstitutionen des Kantons Bern angeboten, um die Anzahl ausgebildeter Lehrerinnen und Lehrer maßgeblich zu erhöhen. Beide Ausbildungsformen setzten eine abgeschlossene Ausbildung auf der Sekundarstufe II voraus – entweder eine gymnasiale Matur oder den Abschluss einer Berufslehre mit entsprechender Berufserfahrung. Diese neuen Ausbildungsmöglichkeiten waren – bildungssystematisch gesehen – also tertiäre Ausbildungsgänge.
Die Kurse für Maturae und Maturi folgten einem Lehrerbildungskonzept, das zwischen dem universitären und dem seminaristischen Konzept angesiedelt war. Der Kanton Basel-Stadt hatte bereits 1892 mit den sogenannten «Fachkursen» in der Schweiz erstmalig ein solches maturitätsgebundenes Lehrerbildungskonzept realisiert. Die Allgemeinbildung der Sekundarstufe II und die berufliche Ausbildung für den Lehrberuf sollten klar getrennt werden und in unterschiedlichen Institutionen stattfinden. Durch die Ausbildung der zukünftigen Lehrer (zunächst nur der Lehrer, nicht der Lehrerinnen!) gemeinsam mit andern zukünftigen Akademikern am Gymnasium sollte der Lehrer «in seiner zukünftigen Lebensstellung eine seines Standes würdige Stufe» einnehmen können (Kinkelin 1890, S. 8). Lehrer sollten als künftige Volksbildner wissenschaftlich denken lernen. Obwohl die Basler glaubten, dass ihr neues Lehrerbildungskonzept «nicht ohne Nachfolge» bleiben würde, wurden ähnliche, tertiäre Lehrerbildungskonzeptionen erst wesentlich später realisiert. Der Kanton Zürich stellte seine Lehrerinnen- und Lehrerbildung mit dem Lehrerbildungsgesetz von 1938 darauf um (Schmid 1982). Der Kanton Genf ging noch einen Schritt weiter, indem er bereits in den 1930er-Jahren das theoretische Ausbildungsjahr seiner tertiarisierten Lehrerinnen- und Lehrerbildung durch die Universität organisieren ließ (Hofstetter 2011). In den 1960er- und 1970er-Jahren folgten dann insbesondere auch die Kantone Basel-Landschaft (Schläpfer 1973) und Aargau (Metz 2000, 2001) dem Basler und Zürcher Vorbild.
Mit dem maturitätsgebundenen Konzept wurden wesentliche Merkmale der seminaristischen Lehrerinnen- und Lehrerbildung, u. a. die enge Verbindung von Allgemeinbildung und Berufsbildung, aber auch die Idee, dass Lehrerinnen und Lehrer am besten in einer mehrjährigen Ausbildung während der noch formbaren Jahre zwischen 16 und 20 Jahren ausgebildet werden sollen, zur Disposition gestellt. Gleichzeitig setzten sich hochschulförmige Ausbildungskonzepte neben der Lehrerinnen- und Lehrerbildung für die Gymnasien und die Sekundarschulen kaum durch. Zwar wurden die Diskussionen über die Integration der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in die Universitäten in andern Ländern in den 1970er-Jahren durchaus wahrgenommen; aber schon die Bestrebungen der EDK, die Kantone im Rahmen des Projekts «Lehrerbildung von morgen» auf ein tertiäres, nicht-universitäres Modell der Lehrerinnen- und Lehrerbildung zu verpflichten, scheiterten (Müller et al. 1975).
Der Tertiarisierungsprozess in der Schweizer Lehrerinnen- und Lehrerbildung war im Kontext der Bildungsexpansion also fortgesetzt worden, die maturitätsgebundene Konzeption hatte an Terrain gewonnen und in vielen Kantonen waren zur Bekämpfung des Lehrermangels mit neuen – tertiären – Lehrerbildungsmodellen Erfahrungen gesammelt worden. Aber das seminaristische Konzept blieb nicht nur in Bern, sondern auch in andern Regionen (Ostschweiz, Zentralschweiz, Fribourg und Solothurn) dominierend; und eine grundlegende Strukturreform blieb in den 1970er-Jahren auch aus, weil die Reformeuphorie im Kontext der wirtschaftlichen Depression Mitte der 1970er-Jahre in Reformskepsis umschlug.
Die Kontexte änderten sich aber am Ende der 1980er- und zu Beginn der 1990er-Jahre noch einmal, und vor diesem Hintergrund schienen in den 1990er-Jahren fundamentale Reformen in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung plötzlich möglich. Motive für den Reformimpetus lassen sich sowohl in regionalen als auch in nationalen und internationalen Kontexten finden (Criblez & Lehmann 2016/im Druck). Auf gesamtschweizerischer Ebene spielte die Schaffung von Fachhochschulen, die als wesentliche Vorbilder für die Pädagogischen Hochschulen gelten können, 11eine wesentliche Rolle. Und die Gymnasialreform ermöglichte es, den allgemeinbildenden Teil der Ausbildungskonzeptionen der Seminare neu als musische oder pädagogisch-sozialwissenschaftliche Maturitätsprofile zu etablieren. Ein wichtiges Motiv für die Reformen in den 1990er-Jahren war zudem die gegenseitige Diplomanerkennung zwischen den Kantonen. Dynamisierend wirkte in dieser Hinsicht vor allem der europäische Integrationsprozess. Obwohl der Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) im Dezember 1992 in der Volksabstimmung abgelehnt worden war, war in diesem Umfeld das Problem der Diplomanerkennung deutlich geworden. Unter Bedingungen der freien Mobilität des Personals in Europa – mit den EWR-Verträgen zwar abgelehnt, über die bilateralen Verträge dann aber doch eingeführt (vgl. Kreis 2009) – entstand das Problem der sogenannten Inländerdiskriminierung. Das Problem lässt sich am besten an einem Beispiel illustrieren: Ein Lehrdiplom aus dem süddeutschen Raum musste im Kanton Aargau formal anerkannt werden, dasjenige aus dem Kanton Zürich oder dem Kanton Bern aber nicht. Die gegenseitige Anerkennung der (Lehr-)Diplome wurde deshalb zu einem der prägenden bildungspolitischen Themen der 1990er-Jahre. Ein Anerkennungsverfahren setzte aber entsprechende Standards voraus, die der Anerkennung zugrunde gelegt werden konnten – und erzeugte dadurch harmonisierende Wirkungen.
Versuche, die Lehrerinnen- und Lehrerbildung zwischen den Kantonen anzugleichen, hatte es allerdings schon vor den 1990er-Jahren gegeben. 12Die EDK hatte ihre Zusammenarbeit 1970 mit dem Schulkonkordat (EDK 1970) auf eine neue Grundlage gestellt. Die Lehrerinnen- und Lehrerbildung war explizit als Thema der Koordinationsbemühungen vorgesehen und die EDK setzte eine Kommission ein, die entsprechende Vorschläge unterbreiten sollte (Lehmann 2013). Unter dem Titel «Lehrerbildung von morgen» erschien 1975 der Bericht der Kommission, die vom Thuner Seminardirektor Fritz Müller präsidiert worden war. Die Experten hatten sich jedoch nicht auf ein einheitliches Konzept für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung einigen können und schlugen einen Kompromiss vor: Die Harmonisierung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung sollte über die Inhalte, nicht über die Konzepte und Strukturen erfolgen. Das maturitätsgebundene und das seminaristische Lehrerbildungskonzept wurden als gleichwertig erachtet unter der Bedingung, dass die seminaristische Lehrerinnen- und Lehrerbildung mindestens fünf Jahre dauert.
Читать дальше