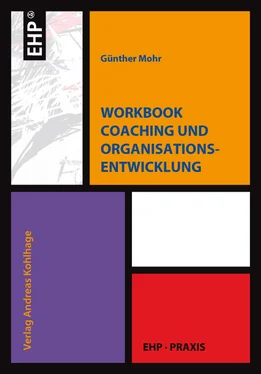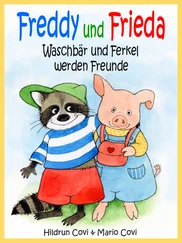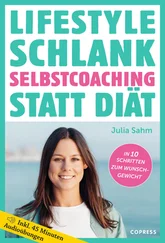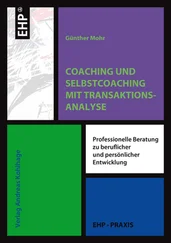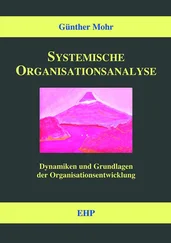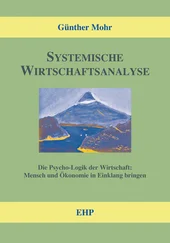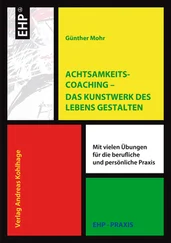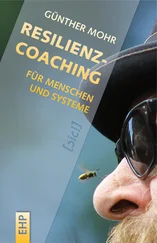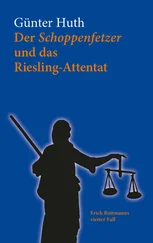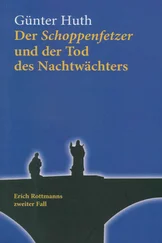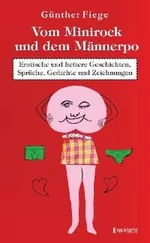Übungen zu Inhalten brauchen immer Vorbereitung. Der Übende muss in eine gute Haltung und Einstellung gebracht werden, sonst fruchtet der beste Inhalt nicht. Mit der Tür ins Haus fallen, empfiehlt sich in den seltensten Fällen. Obwohl die direkte, deutliche Ansprache eines Themas von vielen Rhetoriktrainern gelehrt wird, ist diese »typisch deutsche« Art für viele Menschen in der Welt nicht nachzuvollziehen. Gerade in meiner langjährigen Erfahrung in internationalen Gremien und Gruppen musste ich zu Beginn viel Lehrgeld bezahlen. »Germans are open, direct and rough« (Deutsche sind offen, direkt und rau) war die verhaltene Reaktion vieler Gesprächspartner.
Auch der Hypnotherapeut Bernhard Trenkle rät für den praktischen Einsatz ein ausführliches Hinarbeiten auf Übungen und Interventionen. Man soll zunächst »eine Bühne bauen« (Trenkle 2003). Wer einmal beim Dalai Lama in einem Vortrag war, konnte diese Technik ebenfalls erleben. Der in aller Welt bekannte tibetische Religionsführer und Friedensnobelpreisträger versucht zu Beginn jedes Vortrages ausführlich das Bild von sich zurechtzurücken. Er räumt erst einmal alle positiven Vorurteile aus, etwa er könne heilen, oder er sei in irgendeiner Weise etwas Besonderes. Denn auch positive Vorurteile können durchaus vom Lernen und von der Erkenntnis ablenken.
Zusätzlich macht es Sinn, die unterschiedlichen Aufmerksamkeitsebenen, mit denen Menschen sich auf die Welt beziehen zu berücksichtigen. Dazu können als Orientierung die sechs Bewusstseinsebenen dienen: körperliches, emotionales, rationales, selbstbildbezogenes, mehrgenerationales und nonduales Bewusstsein (Mohr 2009b). Gutes Lernen findet in einer Kombination aller dieser Aufmerksamkeitsebenen statt. Grundlegend zielt transaktionsanalytische Arbeit auf Erkenntnisgewinn und mehr Bewusstheit ab. Transaktionsanalytiker haben nichts dagegen, wenn Symptome von selber oder beiläufig verschwinden, im Gegenteil: Sie freuen sich dann mit ihren Klienten. Leitmotiv der Transaktionsanalyse bleibt aber der sich selbst steuernde Mensch. Dazu ist Erkenntnis und Bewusstheit notwendig. Insofern sind die Übungen auch auf Erkenntnisgewinn gerichtet. Dies ist nicht nur ein Denkprozess, Erkenntnis ist ein ganzheitlicher Prozess aus Einstellung, Fühlen und Verhalten. Weiterhin ist auch das Lernen von Transaktionsanalyse mit einer nichtakademischen Sprache und auch ohne eine erst zu erlernende Fachsprache möglich. Dies macht die folgende Charakterisierung zum Lernen von Verhalten deutlich.
Grafik: Lernen von Verhalten
| 1. oft kein einfaches richtig oder falsch 2. situations- und wesensgemäß 3. »aus dem eigenen Mist« 4. »keine Sonntagsanzüge« 5. »neues Land gewinnen« 6. braucht Wissen/Erkenntnis 7. ereignisgesteuert oder unbewusst 8. abhängig von innerer Haltung 9. erfordert Offenheit 10. im vertraulichen Rahmen |
 |
© Günther Mohr
Die Transaktionsanalyse wurde in einer großen internationalen methodenvergleichenden Studie von Klienten als außerordentlich nützlich eingeschätzt (Novey 2002). Praktisch finden transaktionsanalytische und systemische Modelle auf drei Ebenen der beraterischen Arbeit Eingang:
• Ebene des Tuns in Coaching, Beratung und Organisationsentwicklung : Normalerweise wird in der Beratung nicht »Transaktionsanalyse gesprochen«. Aber der Berater versucht eine O.k.-o.k.-Beziehung zu leben, wertet nicht ab, berücksichtigt die Grundbedürfnisse des Gesprächspartners und gewährleistet Schutz, Erlaubnis und Energie in seiner Arbeit mit dem Klienten. Transaktionsanalyse wird also gelebt. Dies geschieht im Gespräch und Tun des Beraters und wird in der Regel nicht gesondert mit Begriffen der Transaktionsanalyse etikettiert. Hinzu kommt allerdings, dass transaktionsanalytische Modelle hervorragende Illustrationen bei Interventionen sind. Der Erfinder der Transaktionsanalyse, Eric Berne, hat die Bedeutung der Interventionstechnik »Illustration« hervorgehoben (Berne 1966, 237; Mohr 2008). Zudem war Berne auch ein Meister der Begriffsfindung. Unter Marketinggesichtspunkten sind »Ich-Zustand«, »Psychologische Spiele«, »Rackets« und »Ich-bin-ok-du-bist-ok« hervorragend geeignet. Transaktionsanalyse-Modelle werden in diesem Sinne manchmal als Veranschaulichung genutzt. Diese Ebene ist für jeden Gesprächspartner wahrnehmbar. Die sichtbaren Modelle sind dabei so zu wählen, dass sie für den Beratenen auch in seinem Anwendungsfeld weiter nutzbar sind. Beispielsweise wird der Coach einem Gegenüber zur Veranschaulichung einer Konfliktssituation das Drama-Dreieck nutzen.
• Ebene der Beobachtung des Tuns: Der transaktionsanalytische Praktiker schaut auf sein Tun. Diese Aufmerksamkeit ist durch seine Modelle über die menschliche Psyche und das Zusammenwirken von Menschen geprägt. Er diagnostiziert beispielsweise eine Abwertung (Schiffet al. 1975) oder steuert sich mithilfe seiner sozialen Diagnose (Berne 1979, 197), um daraus Interventionsideen abzuleiten. Diese Ebene ist für den Beratenen in der Regel nicht sichtbar. Ausnahmen davon sind Interventionen, in denen der Berater den Beratenen quasi zum Co-Berater einlädt und ihn beispielsweise fragt, wie er eine gerade in der Beratung vorgekommene Sequenz in TA beschreiben würde. Dies ist allerdings nur bei Personen möglich, die schon in transaktionsanalytischen Konzepten erfahren sind.
• Ebene der Beobachtung der Beobachtung: Der Berater überprüft seine Beobachtungsgewohnheiten. Der Berater ist selbst das »Instrument«, das wirksam ist. Deshalb sind die Selbststeuerungsprogramme dieses »Instrumentes« ständig zu reflektieren. Dies bedeutet für den Transaktionsanalytiker, seine Arbeit stetig durch Supervision bezüglich der Qualität und der Effektivität begutachten zu lassen. Auch diese Ebene ist für den Beratenen nicht sichtbar. Er darf allerdings um sie wissen, damit er den transaktionsanalytischen Berater als Modell für gelebtes Lernen sehen kann.
Es ist wie mit den drei übereinander fliegenden Schwänen. Der erste fliegt. Der zweite fliegt und beobachtet dabei den ersten, wie dieser fliegt. Der dritte fliegt und beobachtet dabei den zweiten beim Beobachten des ersten. Bernd Schmid, der maßgeblich die systemische Transaktionsanalyse beeinflusst hat, hat diesen Zusammenhang im Logo seines Instituts für systemische Beratung, Wiesloch, dargestellt.
Was den interaktiven Aspekt anbelangt, so gibt es sehr unterschiedliche Formen der Übung. Gerade für Coaching oder Organisationsentwicklung empfiehlt es sich, die Übungsformen so zu wählen, dass eine gewisse Modellierung des erzielten Kompetenzfeldes erreicht wird. So ist im Coaching eine dyadische (Zweiergruppen-) Form häufig zu nutzen, auch wenn man Selbstreflexion anstrebt, da so die Erfahrung des Fragenden und des zu einem Thema Befragten immer mit trainiert werden kann. Für Organisationsentwicklung bieten sich eher auch Mehrpersonenkonstellationen mit bestimmten Rollenverteilungen (z.B. Consultant, Auftraggeber, Klientensystem) an. Insgesamt ergibt sich für die praktische Übungsgestaltung ein weites Spektrum, aus dem einige Beispiele genannt werden:
• Einzelarbeit: Reflektionsübungen zur eigenen Person oder Rolle.
• Partnerübungen: Dyaden, z.B. strukturierte Übungen mit Coach- und Coachee-Rolle.
• Marktplatzmit wechselnden Dyaden: Bearbeitung einer Reihe von Themen nacheinander mit jeweils unterschiedlichem Partner.
• Triaden: Dreierkonstellationen beispielsweise mit Übendem, Klienten und Beobachter.
Читать дальше