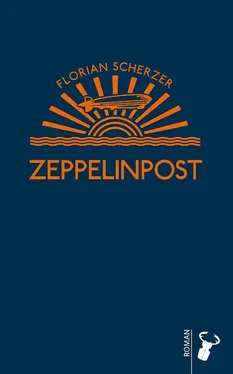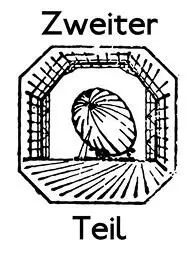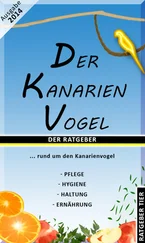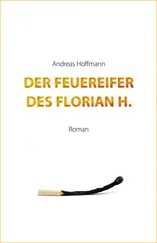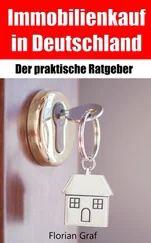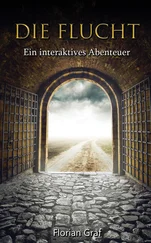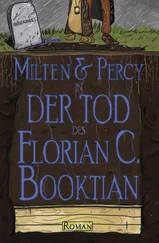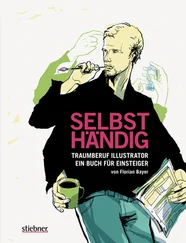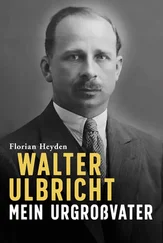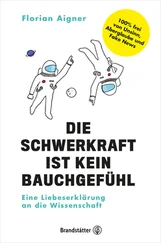Als es endlich soweit war, begann der Restaurator als Erstes damit, die stark verklemmte Schublade mühselig herauszulösen. In der Hoffnung, dort einen kleinen Schatz zu finden. Münzen oder alte Geldscheine, die sich noch an Sammler verkaufen ließen. Das passierte nicht gerade selten. Zwar eher in Nachtkästchen oder Bettgestellen als in Schreibtischen, aber man wusste ja nie. Schließlich konnte man es sogar klappern hören, wenn man den Tisch rüttelte. In der Schublade war aber nichts als ein einzelner sehr dicker Briefumschlag mit vielen maschinengeschriebenen Seiten darin. Zwischendrin hand- und maschinengeschriebene Briefe, an deren Rand kleine Zettel geklebt waren, die offenbar einzelne Passagen der Briefe kommentierten. Das Kompendium war die ausführliche Lebensbeichte eines Carl Dürrnheimer. Die eigentlich viel interessantere Geschichte aus dem Haus in der Zeppelinstraße 41. Spannender als die Lausbubengeschichten aus der Jugend von Karl Valentin. Aber dafür deutlich weniger lustig.
Kagerer schenkte das Bündel Papier meinem Cousin, als er ihm den aufpolierten Schreibtisch für sein erstes Büro abkaufte. Der schenkte es mir, weil »du dich doch für so Historisches interessierst«. Ich las es und wollte meine Facharbeit am Gymnasium darüber schreiben. Mein Geschichtslehrer war dagegen und ich beschloss, im Studium oder später mal irgendeine Arbeit darüber zu schreiben. Irgendwann.
Als ich viele Jahre später unseren Keller räumen musste, weil seit Jahren Abwasser ins Mauerwerk gesickert war und alles renoviert werden musste, fiel mir dieses überraschend gut erhaltene Bündel Papier in die Hände. Gleich daneben fand ich, deutlich aufgeweichter, meinen Collegeblock mit meinen sehr kryptischen Aufzeichnungen von damals, als ich noch dachte, dass dies das Thema meiner Facharbeit sein würde.
Mein Kind ist nun groß genug, um meistens alleine zurechtzukommen, die Frau arbeitet Vollzeit, und ich habe plötzlich Freiräume, die es mir ermöglichen, alles noch einmal von Neuem anzusehen, zu lesen und dieses Buch daraus zu machen:
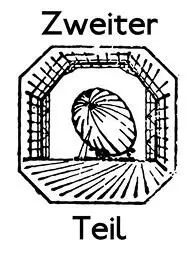
1
München, im April 1933
Mein Name ist Carl Dürrnheimer. 31 Jahre. Geboren am 12. Februar 1902 in Neustadt an der Haardt/Pfalz (Kgr. Bayern). Wohnhaft Zeppelinstraße 41 in München.
Ich werde in den nächsten Stunden verhaftet werden und bin mir sicher, dass ich in den folgenden Wochen wegen des Mordes an meiner Verlobten Therese Aumiller zum Tode verurteilt werde. Oder zumindest zu lebenslänglich. Ich werde mich nicht gegen das Urteil wehren und während des Prozesses schweigen. Wenn es denn einen gibt. Das weiß man ja heutzutage nicht mehr. Ich habe mich zu sehr in einem undurchdringlichen Geflecht aus Geschichten und Erfundenem verstrickt, um jemals mit der Wahrheit glaubwürdig zu sein. Ich wüsste gar nicht, wie ich in dieser Situation noch meine Unschuld beweisen könnte. Das haben mir die beiden Polizisten mehr als deutlich gemacht. Es ist leichter, mich meinem Schicksal zu ergeben als zu kämpfen. Ich bin auch zu erschöpft, um mich noch groß gegen Ermittler und Staatsanwälte aufzubäumen. Mein Leben mit Therese war so erfüllt, dass es mir nicht schwerfällt, einfach auch zu verschwinden, jetzt, wo sie weg ist. Ohne Therese hat mein Leben ohnehin keinen Inhalt mehr. Das muss ich mir eingestehen. Nichts würde mein Weiterleben rechtfertigen. Was soll auch nach diesem wundervollen Jahr mit ihr noch kommen?
Ich schreibe dies, um die Wahrheit von der Seele zu haben. Ohne die Hoffnung, dass dieser Zettelhaufen jemals zu meiner Rehabilitierung beitragen könnte. Ich bin es Therese einfach schuldig, alles niederzuschreiben. Ich schreibe alles nach
bestem Wissen und Gewissen auf. Aber auf mein Gedächtnis ist Verlass. Vielleicht können Sie mich ja ein klein wenig verstehen und merken, dass es Ihnen in meiner Situation nicht anders gegangen wäre.

2
Ich wurde im Jahr 1902 als einziges Kind des Ehepaars Dürrnheimer in Neustadt an der Haardt in der bayerischen Pfalz geboren. Ich hatte wahrscheinlich eine sehr glückliche frühe Kindheit. Meine Erinnerungen daran sind natürlich sehr verschwommen und undeutlich. Deshalb weiß ich es nicht mehr so genau. Aber neben jenen an die Zeiten mit Therese, sind es die schönsten Erinnerungen meines Lebens.
Wir wohnten in einem Haus mit Garten. Die Mutter war für mich da, es gab Nachbarskinder, Tiere, eine Sandkiste und eine Teppichstange zum Turnen. Alles, was sich ein kleiner Bub wünscht. So hat es jedenfalls die Mutter immer erzählt, und so wirkt es auf den wenigen Fotografien, die von damals noch existieren. Ich selbst erinnere mich nur verschwommen an ein Versteck in einem Gebüsch, einen toten Vogel, den wir beerdigten und Lurche oder Molche in einem großen Weckglas. Eine normale Kindheit in einer frohen und zufriedenen Familie. So, wie man es den meisten Menschen wünscht.
In meinen Erinnerungen an den Vater, saß dieser immer in seinem Arbeitszimmer in der oberen Etage und erfand Kreuzworträtsel oder Zahlenrätsel für Zeitungen und Zeitschriften. Ich weiß bis heute nicht, ob das wirklich sein Beruf oder nur eine Nebenbeschäftigung war. Oder ob er mir als Kind nicht erklären konnte, was er wirklich tat. Offenbar war mit seiner Arbeit nicht viel Geld zu verdienen, denn wir verhielten uns zwar gutbürgerlich, waren jedoch in Wirklichkeit eher arm. Meine Mutter war gelernte Laborantin, aber sie kümmerte sich ausschließlich um mich, ihr einziges Kind. Vielleicht wäre es uns besser gegangen, hätte sie gearbeitet und mein Vater wäre bei mir geblieben. Sie hätte bestimmt, obwohl sie nur eine Frau war, mehr Geld nach Hause gebracht als der Vater. Meine Eltern waren sehr liebevoll und fürsorglich. Manchmal zu sehr, manchmal zu wenig. Wie die meisten Eltern wären, wenn sie könnten.
1908 mussten wir nach München ziehen. Er habe eine neue Arbeit angeboten bekommen, die er nicht ausschlagen könne, sagte der Vater. Erst große Vorfreude, dann ein Schock für ein Kind aus der Kleinstadt.
Für eines der modernen, neuen und wohlhabenden Viertel wie Schwabing reichte es natürlich nicht, deshalb zogen wir in das Arbeiterviertel Au. In die Nachbarwohnung der Wohnung, in der die Familie Fey gewohnt hatte. Die Familie des Münchner Komikers Karl Valentin. Das ganze Haus in der Zeppelinstraße, die damals noch Entenbachstraße hieß, hatte ursprünglich den Feys gehört. 1906 jedoch waren Karl Valentin und seine Mutter, nach dem Tod des Vaters und der Pleite der familiären Spedition, nach Zittau umgezogen, und das Haus gehörte von da an erst Adolf Weiß und ab 1910 Ludwig Weinberger. Das wussten weder meine Eltern noch ich. Es hätte uns auch nicht interessiert. Erst nach dem Krieg, als ich einen der Filme Valentins im Kino sah, sagte mir eine Nachbarin, dass er hier im Haus gewohnt hatte.
Als Sechsjähriger war ich begeistert, als ich während der Zugfahrt nach München erfuhr, dass wir in die Entenbachstraße ziehen sollten. Ich erinnere mich noch genau an meine Vorstellung von einem kleinen Bach voller Fische und Enten, an dessen Ufer ich mit meinen neuen Münchner Freunden spielen konnte. Und ich weiß auch noch, wie enttäuscht ich gewesen bin, als ich die graue Stadtstraße von der Droschke aus sah. Ich sei wohl in Tränen ausgebrochen und habe einige Tage durchgeweint und wollte nicht auf die Straße, so erzählte es mir meine Mutter einige Jahre später. Die Entenbachstraße wurde 1910 in Zeppelinstraße umbenannt. Das machte es aber nicht besser. Obwohl ich sagen muss, dass der Name bei dem, worüber ich hier noch schreiben werde, eine gewisse Rolle spielt. Ohne den Straßennamen hätte ich wahrscheinlich nie Zeppelinpost bekommen.
Читать дальше