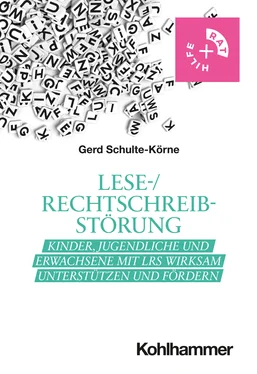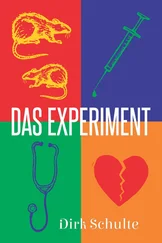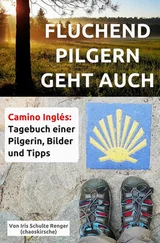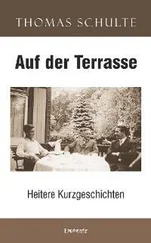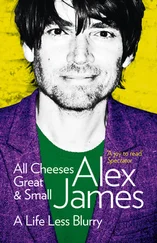Sebastian Meier studiert BWL und leidet seit der Grundschulzeit an einer Lesestörung. Trotz außerschulischer Förderung hat er erhebliche Probleme, Texte zu verstehen, da er sehr viel Zeit braucht, einzelne Sätze zu entschlüsseln. Manche Wörter sind besonders schwer, was dazu führt, dass er für diese Wörter besonders viel Zeit braucht. Ist es ihm gelungen, diese Wörter zu lesen, fehlt ihm, insbesondere bei langen Sätzen, der Inhalt des bereits Gelesenen. Dies führt nicht selten dazu, dass er entmutigt aufgibt und versucht, den Inhalt auf anderen Wegen zu bekommen. Im Alltag kommt er aber immer wieder in schwierige Situationen, wenn er z. B. unter Zeitdruck etwas lesen muss. So passiert es ihm immer wieder, dass er sich bei Straßennamen verliest und dann viel länger zum Ziel braucht. Auch im Studienseminar hat er häufig Angst vor Situationen, in denen in recht kurzer Zeit ein Text gelesen und dann darüber referiert werden muss. Er hat manchmal fast panische Angst davor, aufgerufen zu werden. Dies erinnert ihn oft an seine Schulzeit, wo er auch immer Angst vor solchen Situationen hatte.
Es gibt eine Reihe von Strategien, die helfen können, mit den Leseanforderungen im Alltag und im Beruf umzugehen. Generell stellt sich oft die Frage, ob eine Förderung im Erwachsenenalter sinnvoll ist. Liegt eine ausgeprägte Lesestörung vor, ist die Frage klar mit ja zu beantworten, da auch im Erwachsenenalter eine Leseförderung hilfreich sein kann. Die Förderangebote sind jedoch meist nicht spezifisch für Erwachsene mit einer Lesestörung, sondern beruhen auf Konzepten, die für Kinder und Jugendliche entwickelt wurden. Diese sind auch für Erwachsene geeignet, meist ist allerdings der Inhalt sehr kinderspezifisch und der Wortschatz nicht für das Erwachsenenalter ausreichend. Erwachsenenbildungsstätten bieten teilweise Alphabetisierungskurse an, um Erwachsenen zu helfen, die entweder aufgrund fehlender Sprachkenntnisse oder aufgrund geringer Schriftsprachkompetenzen, bedingt durch psychosoziale Probleme in der früheren Entwicklung, geringere Lesefertigkeiten haben. Diese Kurse sind meist für Erwachsene mit einer Lesestörung nicht geeignet, da der Förderansatz nicht spezifisch auf ihren Förderbedarf ausgerichtet ist. Trotzdem sollte man sich bei der lokalen Volkshochschule oder anderen lokalen Bildungsträgern erkundigen, ob es Förderangebote für Erwachsene mit einer Lesestörung gibt. Hilfreich ist auch der Kontakt zu dem jeweiligen Landesverband des Bundesverbandes Legasthenie und Dyskalkulie e. V., der zusätzlich zur Beratung auch Informationen zu lokalen Angeboten für die Diagnostik und Förderung geben kann. Im Bundesverband gibt es eine Interessengruppe von jungen Erwachsenen mit einer LRS (JA – Die Jungen Aktiven) ( 
Kap. 17
), die ebenfalls Informationen bereitstellt und berät.
Liegen aufgrund der LRS und damit verbunden eine psychische Erkrankung vor, wie z. B. eine Prüfungsangst, ist eine psychotherapeutische Behandlung sehr hilfreich. Dazu muss vorher eine Diagnostik zur Frage durchgeführt werden, ob und welche psychische Erkrankung vorliegt und ob eine Empfehlung zur psychotherapeutischen Behandlung gegeben werden kann. Die Diagnostik wird von Fachärzten für Psychiatrie und Psychotherapie, von Fachärzten für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie und bei Heranwachsenden, die bereits zuvor in der Kinder- und Jugendpsychiatrie vorgestellt wurden, von Fachärzten für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie angeboten. Die Behandlungskosten für die psychotherapeutische Behandlung werden von den gesetzlichen und privaten Krankenkassen gemäß dem individuellen Vertrag erstattet.
Die Gewährung von Nachteilsausgleich ist auch bei Erwachsenen in Prüfungen möglich, dies setzt meist ein fachärztliches Attest voraus. Die Entscheidung, ob der Nachteilsausgleich gewährt wird, hängt von den jeweiligen Ausbildungsstätten ab. In jedem Fall sollte man sich mit der Vertretung der Menschen mit einer Behinderung in Verbindung setzten und prüfen, welche Erfahrungen bisher dazu in der Institution mit der Gewährung von Nachteilsausgleich bestehen und wie die gesetzlichen Regelungen sind. Leider ist es manchmal notwendig, sein Recht auf Nachteilsausgleich einzuklagen.
5 Woran erkenne ich eine Rechtschreibstörung?
Eine Rechtschreibstörung sollte erst ab Mitte der zweiten Klasse diagnostiziert werden, jedoch lassen sich bereits in der ersten Klasse Hinweise für eine Rechtschreibstörung finden. Diese Anzeichen erlauben, frühzeitig den Bedarf an spezifischen Hilfen und Unterstützung zu erkennen und diese zur Verfügung zu stellen.
Anzeichen für eine Rechtschreibstörung in der ersten Klasse sind z. B. anhaltende Probleme, Laute zu unterscheiden ( 
Kap. 2 2 Gibt es schon im Kindergarten Hinweise für ein Risiko für Lese- und oder Rechtschreibschwierigkeiten? Frühzeitig ein Risiko für eine Lese- und/oder Rechtschreibstörung zu erkennen, kann von großer Bedeutung sein, um durch Frühförderung die Folgen eines Entwicklungsrisikos abzumildern. Allerdings ist es nicht einfach, ein Risiko zu erkennen. Außerdem gibt es Vorbehalte gegenüber einer frühen Identifikation eines Risikos. Die Befürchtung ist, dass dies zu einer Verunsicherung oder sogar zur Stigmatisierung eines Kindes führen kann, wenn fälschlicherweise ein Entwicklungsrisiko festgestellt wird. Daher werden Programme zur Frühförderung im Kindergarten nicht selten mit der ganzen Kindergartengruppe durchgeführt, da Studien gezeigt haben, dass zusätzlich zu den Kindern mit einem Risiko für eine Lese- und Rechtschreibstörung auch die Kinder ohne ein Entwicklungsrisiko von der Frühförderung profitieren können.
) und den Lauten die entsprechenden Grapheme zu zuordnen (z. B. dem Laut /b/ in Ball das Graphem B). Meist gibt es schon Hinweise aus dem Kindergarten, dass Probleme beim Finden von Reimwörtern und Erkennen von Silben bestanden. Insbesondere die fehlende Kenntnis von Buchstaben ist häufig bei Kindern mit einem Risiko für eine Rechtschreibstörung.
Die Rechtschreibstörung tritt ebenso wie die Lesestörung gehäuft familiär auf. Sind ein Elternteil und/oder ein Geschwister von einer Rechtschreibstörung betroffen, so liegt das Risiko für das weitere Kind bei ca. 50–70 % für eine Rechtschreibstörung, wie Zwillingsstudien zeigen.
Beim Schreiben fällt auf, dass die Kinder zum Teil nur einzelne Grapheme und unvollständige Wörter schreiben. Meist stimmt auch die lautliche Entsprechung des Graphems nicht (z. B. das Graphem wird anstatt (Torde) bei dem Wort Torte geschrieben. Oder oft als Wortruine bezeichnete Verschriftlichung von Wörtern, wie z. B. kaszimr für Klassenzimmer, treten auf.
Mit dem Fortbestehen der Rechtschreibprobleme nimmt die Motivation und das Interesse am Schreiben ab. Bei schriftlichen Äußerungen und Textproduktion schreiben die Kinder mit einer Rechtschreibstörung meist weniger, verwenden meist einfache Satzkonstruktionen und haben viele Rechtschreibfehler.
Typische Rechtschreibfehler, die diagnostisch auf eine Rechtschreibstörung hinweisen, gibt es allerdings nicht.
Die Rechtschreibfähigkeit entwickelt sich ebenso wie das Lesen in Phasen. Steht zu Beginn des ungestörten Rechtschreibprozesses der systematische Erwerb der Zuordnung der Phoneme zu den Graphemen, erwerben die Kinder in der nächsten Phase Wissen über orthografische Regelmäßigkeiten. Diese Regelmäßigkeiten finden sich z. B. im Wortstamm, der auch Morphem genannt wird. Ein paar Beispiele sollen dies verdeutlichen. Zunächst Beispiele für orthografische Regelmäßigkeiten.
Читать дальше