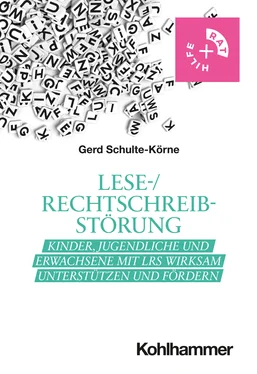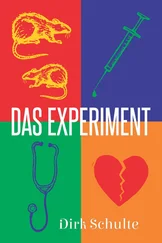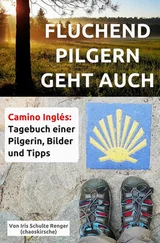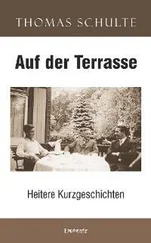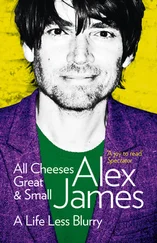Weitere Anzeichen einer Lesestörung sind abnehmendes Interesse und Spaß am Lesen. Auch im Alltag vermeiden die Kinder, Dinge zu lesen und fragen eher nach, was auf dem Schild, der Verpackung oder in der WhatsApp-Nachricht steht.
Da die fehlende Lesepraxis verbunden mit geringer werdender Motivation zum Lesen und geringem schulischen Fortschritt im Lesen zusammen sich nachteilig auf die gesamte Leseentwicklung auswirken, entwickeln manche Kinder, wenn diese Problematik nicht erkannt und nicht gegengesteuert wird, psychische Symptome. Die häufigsten sind Ängste, spezifisch vor dem Fach Deutsch und den Leistungsanforderungen in diesem Fach. Diese Ängste drücken sich in morgendlichen Beschwerden, wie starke Kopfschmerzen oder akute Bauchschmerzen aus, wie das nachfolgende Fallbeispiel beschreibt.
Martin ist in der zweiten Klasse. Er ist der älteste von drei Kindern, sein Vater hatte als Kind eine ausgeprägte Lesestörung, Martin selbst war bisher in der Schule wegen Leistungsproblemen nicht aufgefallen. Die Eltern berichten, dass Martin eines morgens über so starke Bauchschmerzen klagte, dass er erst gar nicht aufstehen konnte. Aufgrund der starken Beschwerden fahren die Eltern mit Martin zum Kinderarzt, der Martin gründlich untersucht. Der Verdacht, dass es eine Blinddarmentzündung sein könnte, bestätigte sich nicht. Mit einer Schmerztablette und dem Rat, falls es wieder auftreten sollte, Martin nochmals vorzustellen, kehren die Eltern mit Martin heim. An den darauffolgenden Tagen ging Martin wieder zur Schule, Bauchschmerzen traten nicht wieder auf. Eine Woche später, am selben Wochentag, traten wieder die Bauchschmerzen auf und Martin wurde erneut gründlich vom Kinderarzt untersucht. Dies wiederholte sich fünfmal, bis die Eltern einen Anruf von der Klassenleitung bekam, die auch Deutschlehrerin ist, die berichtete, dass Martin immer an dem Tag, an dem er eine Doppelstunde Deutsch habe, nicht in die Schule kommt. Er hätte auch kürzlich einen Test deswegen verpasst. In dem darauffolgenden Gespräch mit der Klassenlehrerin berichten die Eltern, dass Martin in den letzten Wochen zusätzlich zu den Bauchschmerzen auch kaum Lust gehabt habe, die Hausaufgaben zu machen. Diese würde zum Teil mehrere Stunden dauern. Die Deutschlehrerin berichtet, dass ihr aufgefallen sei, dass Martin sich mit dem Lesen schwertue. Wenn sie ihn auffordere, einen Satz aus der Fibel laut vorzulesen, würde er sehr erschreckt reagieren, manchmal einen roten Kopf bekommen und nur sehr holprig vorlesen. Sie hätte bisher gedacht, dass sich dies schon legen und Martin sich mit der Zeit auch verbessern würde, denn in den anderen schulischen Bereichen sei er sehr gut. Sie empfiehlt Martin und seinen Eltern, eine Untersuchung durchzuführen, ob vielleicht eine Lesestörung vorliege oder um zu klären, ob es andere Ursachen für die Leseprobleme gäbe.
Liegen Anzeichen für eine Lesestörung vor, sollte mit einer Diagnostik ( 
Kap. 7
) nicht gewartet werden. Das Ziel der Diagnostik ist, herauszuarbeiten, ob es sich nur um vorübergehende Schwierigkeiten beim Lesen handelt oder eine Lesestörung vorliegt. Außerdem können die Ergebnisse der Diagnostik die Basis für wichtige Empfehlungen zur Förderung beim Lesen darstellen.
Stehen körperliche Symptome im Vordergrund, wie Bauch- und Kopfschmerzen, ist nach einer gründlichen Untersuchung beim Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, bei der möglicherweise keine organischen Ursachen festgestellt werden, die kinder- und jugendpsychiatrische Untersuchung notwendig.
Bestätigen die Anzeichen das Vorliegen einer Lesestörung, sollte zeitnah das Kind entsprechend seiner Probleme im Lesen gefördert werden ( 
Kap. 12 1.2 Fallbeispiel Die Mutter von Max beobachtet bereits in der ersten Klasse, dass ihr Sohn, anders als seine älteren Brüder, erheblich langsamer das Lesen lernt und dabei auch viele Fehler macht. Das Lesen ist für ihn insgesamt sehr anstrengend. Bereits am Ende des ersten Schuljahres hat er die Lust am Lesen verloren, trotz ermutigender Unterstützung. Die Mutter wendet sich an die Deutschlehrerin, die aber wiegelt ab und sagt, die Mutter möge noch etwas Geduld mit Max haben, er wird dies schon aufholen. Es gäbe noch weitere Kinder in der Klasse, die so wie Max lesen würden. Max Mutter ist aber doch in Sorge, dass die Frustration in der Schule bei Max sich auf die anderen Fächer ausweiten könnte. Eine befreundete Mutter rät ihr, Max doch mal bei einer Kinder- und Jugendpsychiaterin untersuchen zu lassen. Trotz einer gewissen Unsicherheit, ob dieser Schritt notwendig ist, macht Max Mutter in der Praxis einen Termin aus. Nach mehreren Untersuchungen stellt die Ärztin bei Max eine Lesestörung gemäß den diagnostischen Kriterien des ICD-10 fest und schreibt ein Attest für die Schule. Sie empfiehlt eine spezifische Förderung zur Verbesserung der Lesegeschwindigkeit. Damit geht Max Mutter zur Deutschlehrerin, die das Attest zur Kenntnis nimmt, aber der Mutter erklärt, dass es sich hier um eine schulische Problematik handelt und dass die Entwicklungsverzögerung im Lesen von Max durch zusätzliche Hilfen und Lernmaterial, das sie Max geben würde, sich mit der Zeit bessern wird. Eine spezifische Behandlung sei nicht notwendig. Dieses Fallbeispiel verdeutlicht die unterschiedlichen Perspektiven, die die verschiedenen Professionalitäten in Bezug auf die Lese- und/oder Rechtschreibstörung einnehmen. Dies führt jedoch zu unterschiedlichen Empfehlungen, in diesem Fall ist die abwartende Haltung der Lehrkraft nicht zu empfehlen, da bereits in der ersten Klasse durch Förderung das Entwicklungsrisiko für eine Lesestörung verringert werden kann.
).
4 Lesestörung bei Erwachsenen
Oft besteht die Lesestörung bis ins Erwachsenenalter. Im Vordergrund stehen nicht die Lesefehler, sondern die langsame Lesegeschwindigkeit. Sind allerdings die Wörter aufgrund ihrer Länge oder weil sie selten sind, wie z. B. Fremdwörter, schwer zu lesen, stellen sie für die Betroffenen eine große Hürde da. Die stark beeinträchtigte Lesegeschwindigkeit wirkt sich beim Lesen von längeren Texten besonders stark aus. So bereiten Fachtexte, die im Beruf oder in der Ausbildung gelesen werden müssen, große Probleme, weil der Inhalt des Gelesenen meist durch die hohe Lesezeit nur unvollständig entnommen werden kann. Können einzelne Sätze nur mit großer Mühe und Zeit entschlüsselt werden, so verlieren die Lesenden den Gesamtzusammenhang des Textes und beginnen oft wieder mit dem Anfang des Textes. Eine Erschwernis sind kleingedruckte Texte mit geringerem Wort- und Zeilenabstand. Auch schlecht strukturierte Texte, die kaum Absätze und Paragrafen haben, sind für Menschen mit einer Lesestörung eine unnötige Herausforderung. Die Leseprobleme zeigen sich im Alltag häufig, wenn unter hohem Zeitdruck Sätze und Texte gelesen werden müssen.
Aufgrund der neurobiologischen Basis der Lesestörung sind basale Prozesse im Gehirn verändert, die für die geschwindigkeitsabhängige Verarbeitung von Buchstaben und Lauten, den Zugriff auf ein Wortgedächtnis sowie den Abruf dieses Wissens bedeutsam sind. Im Rahmen der spezifischen Förderung werden diese Prozesse zwar trainiert und die Geschwindigkeit verbessert sich auch, trotzdem handelt es sich um einen Kompensationsprozess. Dies bedeutet, dass der Leseprozess im Erwachsenenalter verlangsamt und auch fehleranfällig ist. Im Rahmen der Behandlung der Lesestörung entwickeln Jugendliche zusätzliche Strategien, mit der Lesestörung zu leben und diesen Aspekt in ihr Leben zu integrieren. Denn nicht nur das Ergebnis der Schulabschlussprüfung kann durch die Lesestörung stark beeinflusst werden, sondern auch die Entscheidung über die an den Schulabschluss sich anschließende Aus- und Weiterbildung. Da die Lesestörung von vielen Betroffenen noch immer als ein Stigma erlebt wird und sie nicht offen über ihre Erkrankung sprechen wollen und können, entstehen im Alltag immer wieder schwierige Situationen, wie das nachfolgende Fallbeispiel verdeutlicht.
Читать дальше