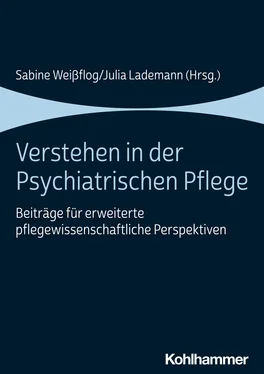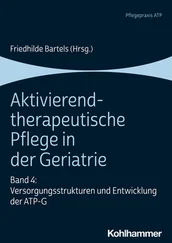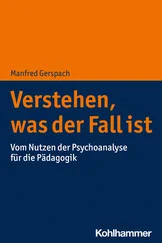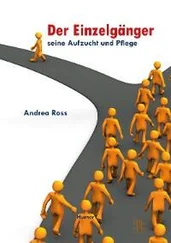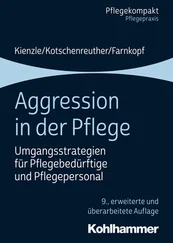»Herauslösung aus historisch vorgegebenen Sozialformen und -bindungen im Sinne traditionaler Herrschafts- und Versorgungszusammenhänge (Freisetzungsdimension), Verlust von traditionalen Sicherheiten im Hinblick auf Handlungswissen, Glauben und leitende Normen (Entzauberungsdimension) und - womit die Bedeutung des Begriffs gleichsam in ihr Gegenteil verkehrt wird - eine neue Art der sozialen Einbindung (Kontroll- bzw. Reintegrationsdimension).« (Beck 1986, S. 206)
Individualisierung bewirkt auf diese Weise »eine Rationalisierung sozialer Beziehungen im Hinblick auf ihren persönlich-privaten Sinn.« (Brock 1994, S. 259)
Die biographische Sichtweise hob die Norm der Familie und der Klasse auf, an ihre Stelle trat die Norm des Arbeitsmarktes. Auch wenn die Individuallage von der institutionsabhängigen Kontrollstruktur, aufgrund der Abhängigkeit vom Arbeitsmarkt, der Bildung und den sozialrechtlichen Regelungen, vergesellschaftet wurde, hätte die industrielle Moderne zu einer klassenlosen Gesellschaft führen können. Als Folge der ökonomischen Vernunft, in Strukturen der Macht unterlag die Individualisierung dem Herrschaftsverhältnis. Rückblickend ist die Herrschaftsfreiheit in der nachindustriellen Gesellschaft für Andreas Reckwitz (2020) eine optische Täuschung und in der Folge »[…] die Singularisierung des Sozialen in der Spätmoderne nicht das Ende, sondern [der] Anfang einer neuen Klassengesellschaft […].« (Reckwitz 2020, S. 276) Die spätmoderne Gesellschaft löste die Moderne ab und folgt der sozialen Logik des Besonderen: »[Die] Etablierung einer postindustriellen Ökonomie der Singularitäten und der Aufstieg der digitalen Kulturmaschine bilden das strukturelle Rückgrat der spätmodernen Gesellschaft der Singularitäten.« (Reckwitz 2020, S. 273) »[…] [A]llgemeine Prozesse der Ökonomie, der Technologien und auch des Wertewandels wirken sich auf die gesamte Gesellschaft und auf alle in ihr lebenden Subjekte in sämtlichen Milieus aus.« (Reckwitz 2020, S. 274) Der singularistische Lebensstil ist getragen von Authentizität und Selbstverwirklichung sowie von Lebensqualität und Kreativität, in seiner reinsten Form in der neuen Mittelklasse, die über ein hohes kulturelles Kapital in Form akademischer Bildungsabschlüsse verfügt und in Berufen der Wissens- und Kulturökonomie tätig ist. Auch wenn es sich bei dieser Klasse um ein Drittel der Bevölkerung in der westlichen Welt handelt, wirkt die Sozialstruktur auf alle Klassen. Die materiellen Ressourcen (Einkommen und Vermögen) bestimmen den Lebensstil und unterscheiden die Klassen voneinander. Die ehemalige Mitte – mit ihrem »sozialdemokratischen Konsens« und niederem oder auch keinem kulturellen und ökonomischen Kapital – bildet die neue Unterklasse, die auch ein Drittel der Bevölkerung ausmacht. Zwischen der neuen Mittelklasse und der neuen Unterklasse befindet sich die alte nichtakademische Mittelklasse. Die Klassenunterschiede und soziale Ungleichheiten werden durch materielle Ressourcen bestimmt, wobei für die Akademikerklasse das kulturelle Kapital bestimmend ist. In der spätmodernen Gesellschaft entscheidet der Faktor Bildung über den Lebensstandard und Lebensstil (Reckwitz 2020). Auch wenn der singularistische Lebensstil der Spätmoderne allen Individuen die Selbstverwirklichung verspricht, können nicht alle davon profitieren. Deshalb stellt sich an dieser Stelle fast zwingend die Frage: Welche Antworten hat die Sozialpolitik auf die soziale Ungleichheit in der Gesellschaft?
Die Theorie der deutschen Sozialpolitik geht auf Gerhard Weisser und die Verteilung von Lebenslagen zurück. Eng verknüpft ist dieses Lebenslagenkonzept mit dem Godesberger Programm der SPD (1959): »[…] gerechte Beteiligung aller am Ertrag der Volkswirtschaft [und] Lebensbedingungen schaffen, unter denen alle Menschen […] eigenes Vermögen bilden können.« (Godesberger Programm 1959).
Unter der Lebenslage versteht die Sozialpolitik »[…] ressourcenabhängige Handlungsspielräume der Person im Lebenszyklus.« (Schulz-Nieswandt 2006, S. 29) In der Annahme, dass die Entwicklung der Persönlichkeit von An- und Herausforderungen im Lebensverlauf geprägt ist, sehen die Akteure der Sozialpolitik ihre Aufgabe, »[…] als [eine] grundrechtlich fundierte Einflussnahme auf die Gestaltung und Verteilung von Lebenslagen.« (Schulz-Nieswandt 2006, S. 13)
Das lebenslagenorientierte Teilhaberecht des Individuums basiert auf der Verteilung des sozialgesetzgeberisch verallgemeinerbaren Wohlstands, ist ökonomisch organisiert und objektivierbar. Die individuellen Fähigkeiten, z. B. der psychisch erkrankten Menschen, die für eine freie Persönlichkeitsentfaltung über den gesamten Lebenslauf notwendig sind, berücksichtigt das lebenslagenorientierte Teilhaberecht nicht – womit wir wieder bei der Berufsgruppe psychiatrische Pflege wären, auf deren mögliche Entidentifizierung bzw. Ent-Subjektivierung/Emanzipation ich hinaus möchte.
Das Handeln der psychiatrischen Pflegefachpersonen ist von kollektiven und institutionellen, rechtlichen und gesellschaftlichen Zuschreibungen abhängig und muss sich an den ressourcenabhängigen Handlungsspielräumen der Klienten orientieren. Ihre Sorge gilt einer »guten« Pflege und sie haben die Befürchtung, den Bedürfnissen der psychisch erkrankten Menschen nicht gerecht werden zu können (Weißflog et al. 2010; Weißflog 2014). Auch wenn ich sie nicht als homogene Gruppe sehen kann, verbindet sie ihr Aufgaben- und Tätigkeitsbereich, der zwischen den verschiedenen Feldern der psychiatrischen Versorgung und in Abhängigkeit des interdisziplinären Teams divergiert.
Grundpflegerische Tätigkeiten sind laut Gesetz (Pflegeberufereformgesetz § 4) den entsprechend ausgebildeten Pflegepersonen vorbehalten (Bundesgesetzblatt 2017). Das Ziel (Pflegeberufereformgesetz § 5) der beruflichen Ausbildung in der Pflege ist die »[…] selbstständige, umfassende und prozessorientierte Pflege [der Pflegeprozess] von Menschen aller Altersstufen […].« (Bundesgesetzblatt 2017, S. 2583)
Pflege »[…] umfasst präventive, kurative, rehabilitative, palliative und sozialpflegerische Maßnahmen zur Erhaltung, Förderung, Wiedererlangung oder Verbesserung der physischen und psychischen Situation der zu pflegenden Menschen, ihre Beratung sowie ihre Begleitung in allen Lebensphasen und die Begleitung Sterbender. Sie erfolgt entsprechend dem allgemein anerkannten Stand pflegewissenschaftlicher, medizinischer und weiterer bezugswissenschaftlicher Erkenntnisse auf Grundlage einer professionellen Ethik. Sie berücksichtigt die konkrete Lebenssituation […]. Sie unterstützt die Selbstständigkeit der zu Pflegenden und achtet deren Recht auf Selbstbestimmung.«
(Bundesgesetzblatt 2017, S. 2583)
Die zur selbstständigen, umfassenden und prozessorientierten Pflege hinzukommende ärztliche Assistenz führte zu einem Doppelmandat und im Arbeitsfeld zu einer Profilunschärfe.
»Je höher der kurative und damit ärztliche Aufwand in der Patientenbetreuung ist, desto höher ist meist auch der weisungsgebundene Anteil der Pflegearbeit (Medikamentengabe, Überwachungs-, Kontroll- und Maschinenarbeit) und desto geringer ist in Relation dazu der autonome Anteil im Sinne direkter Pflege. […] [W]ird ein chronischer Krankheitsverlauf absehbar oder liegt ein Mensch im Sterben […] nimmt die autonome Pflege zu.«
(Hofmann 1999, S. 3293)
In der psychiatrischen Akutbehandlung überwiegt die Mitarbeit an diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen dann, wenn die medikamentöse Therapie im Fokus steht.
Die Pflegeausbildung befähigt zur selbstständigen Ausführung des Pflegeprozesses, der als Vorbehaltsaufgabe einem kybernetischen Regelkreis unterliegt. Nach Verena Fiechter und Martha Meier (1992) muss die Pflege als strukturierter Problemlöseprozess gestaltet werden. Sie definierten den Pflegeprozess als erste für den deutschsprachigen Raum und erweiterten das Pflegeprozessmodell in ein 6-Phasen-Modell (Informationssammlung, Festlegen des Pflegeproblems, Festlegen der Pflegeziele, Planung der Pflegemaßnahmen, Durchführung der Pflege, Beurteilung der Wirkung der Pflege) als eine »[…] systematische patientenorientierte Pflegeplanung im Sinne der Problemlösung […] .« (Fiechter & Meier 1992, S. 17)
Читать дальше