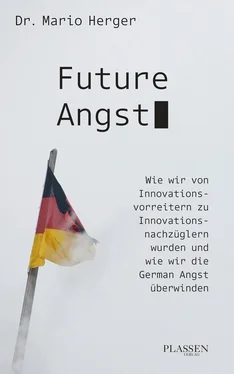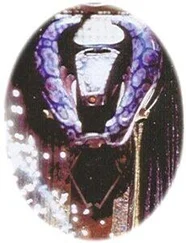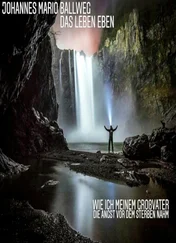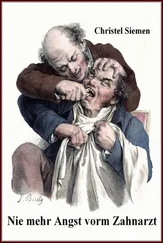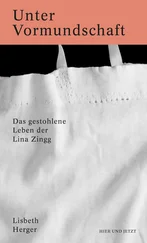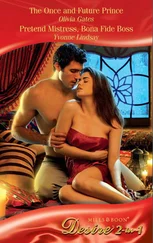Angesichts der Tatsache, dass Kinder in diesem Alter ohnehin bereits eifrig in unterschiedlichen sozialen Medien unterwegs sind, sabotieren hier unter anderem die Eltern die Fortführung des schulischen Betriebs in einer Krisensituation. Der Datenschutz ist heiliger als die Schulbildung der Kinder. Angesichts der Todesfälle während der Pandemie in Europa und den USA im Vergleich zu China wird dies zu einem Problem mit tödlichen Konsequenzen. Wie Jürgen Gerhards und Michael Zürn in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schreiben, komme … 3
… man nicht darum herum, Informationen über das Bewegungsverhalten der Bürger und ihre Kontakte zu erheben. Dies stellt einen zumindest temporären Eingriff in die Privatsphäre dar. Wie bei allen politischen Zielkonflikten wäre hier eine öffentlich diskutierte Güterabwägung zwischen den drei zentralen Zielen „Vermeidung hoher Infektionen und einer hohen Sterblichkeit“, „Vermeidung eines Lockdowns mit hohen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgeschäden“ und „Schutz der informationellen Privatsphäre“ nötig gewesen. Eine solche Diskussion hat faktisch nicht stattgefunden. Stattdessen wurde sehr früh die Privatsphäre als sakrosankt gegenüber staatlichen Eingriffen erklärt. Wie die Erfahrungen demokratischasiatischer Länder aber zeigen, lassen sich durchaus Möglichkeiten finden, das Tracking von Personen mit dem Schutz der Privatsphäre zu verbinden.
Die Autoren sparen nicht mit Kritik an dieser – wie sie schreiben – „eigenartigen Schieflage bei der Gefahreneinschätzung“:
Insbesondere das zweite Versäumnis [Informationen über das Bewegungsverhalten, Anm.] verweist auf eine eigenartige Schieflage bei der Gefahreneinschätzung im Zuge der Digitalisierung innerhalb des Westens. Der Missbrauch von Daten ist fraglos ein reales Problem. In Westeuropa und Nordamerika neigt man vor diesem Hintergrund dazu, dem Staat digitale Eingriffe in die Privatsphäre weitgehend zu untersagen, aber zugleich der Kolonisierung der persönlichen Daten durch private Digitalgiganten tatenlos zuzusehen. Das ist der falsche Weg. Es bedarf einer scharfen Kontrolle der Unternehmen bei gleichzeitiger Handlungsermöglichung des Staates, insoweit er Gemeinwohlzwecke wie Gesundheit oder Verbrechensbekämpfung verfolgt.
Woher kommt diese Skepsis vor Technologie und Fortschritt in einem Kulturkreis, der sich seiner Ingenieure rühmt und German/Swiss/Austrian Engineering zu einem Markenzeichen für hochpräzise, verlässliche Technologien aller Art gemacht hat? Von Schweizer Feinmechanik, deutschem Automobil- und Maschinenbau bis hin zu österreichischen Seilbahnen und dem Tunnelbau – um nur ein paar zu nennen – finden sich auf der ganzen Welt Technologie und Ingenieure aus unserem Kulturkreis im Einsatz. Mit deutschen Maschinen werden weltweit die Güter der Welt produziert.
Wie gelangten wir von einer Gründerwelle von vor eineinhalb Jahrhunderten, die unseren Kulturkreis ergriffen und das Bild des schläfrigen deutschen Michels korrigiert hatte, zu diesem Zaudern und Zögern, zu dieser Ängstlichkeit, ja sogar zu dieser offenen Feindseligkeit gegenüber Wandel und Fortschritt? Warum lassen wir uns von übertriebenen Gefahren und falschen und falsch verstandenen Argumenten einschüchtern, die uns in einer Art Massenhysterie zu Fortschrittsfeinden machen? Selbst dort, wo das Neue viel besser für uns und die Umwelt ist als das Alte, sehen wir nur die Fehler des Neuen. Ja, eine Digitalkamera ist in der Herstellung umweltschädlich, aber Fotos einer Analogkamera auf Filmpapier zu entwickeln war immer ein chemischer Prozess, der über die Lebensdauer viel weniger nachhaltig ist.
Im vorliegenden Buch werden wir dazu viele Beispiele aus der Vergangenheit und Gegenwart sowie Gründe dafür besprechen wie auch Vorschläge für eine ausgewogenere Position, weg von einer für Menschen außerhalb unseres Sprachraums recht hysterischen Sichtweise auf Technologie und Fortschritt hin zu einer, wie ich hoffe, realitätsnäheren.
Sebastian Thrun, der in den USA lebende ehemalige Stanford-Professor für künstliche Intelligenz und Gewinner der DARPA Grand Challenge für autonomes Fahren, antwortet in einem Interview mit der Zeitschrift Forbes auf die Technologieskepsis mit folgenden für deutsche Ohren ungewohnt optimistischen Worten: 4
Nun, zuallererst, jeder, der pessimistisch ist, bitte nicht. Bitte seien Sie nicht pessimistisch. Natürlich sind die Zeiten immer unsicher, aber wir haben uns gerade bewiesen, dass wir ein unglaublich großartiges Verfassungssystem in diesem Land haben. Wir haben enorme Fortschritte gemacht, fast alles, was Ihnen in Bezug auf Technologie wichtig ist – von Ihrem Smartphone über Ihre Toilettenspülung bis hin zu Ihrem Lichtschalter in Ihrem Haus, den Sie sicher alle zu schätzen wissen –, ist nicht älter als 150 Jahre. Das Flugzeug, das Smartphone, richtig? Die Vollnarkose bei Operationen, die Hüftprothese, Dinge, die vielen von Ihnen am Herzen liegen, sind nicht älter als 150 Jahre. Und ich sage 150 Jahre, weil ich die Menschheit – Menschen, Homo sapiens – auf etwa 300.000 Jahre datiere. Wenn wir also 300.000 Jahre nehmen und auf 150 Jahre schauen, ist das wie nichts. Es ist wie eine Mikrosekunde. Wenn das nun der Fall ist, wenn wir all diese wichtigen Dinge in den letzten – fast ausschließlich, nicht ganz, der Großteil war in Europa –, aber fast ausschließlich in den letzten 150 Jahren erfunden haben, was bringen uns dann die nächsten 150 Jahre? Werden wir einfach aufhören, Dinge zu erfinden? Ganz ehrlich? Ich denke, wir befinden uns in einer sich beschleunigenden Kurve von großartigen neuen Erfindungen. Und wir stehen erst am Anfang.
Die teleologische Frage, die sich aus dieser Betrachtungsweise ergibt und die wir uns stellen sollten, lautet: Was ist unsere Aufgabe, unsere Mission in der Welt? Wollen wir ein relevanter Teil dieser nächsten 150 Jahre sein und einen positiven Beitrag dazu leisten oder wehren wir uns dagegen und verraten damit einen Teil unserer eigenen Geschichte?
Wie schön wäre Technik ohne Menschen
Wer in den USA mit dem Auto unterwegs ist, wird rasch bemerken, dass die Kreuzungen anders geregelt sind als in Europa. Besonders in der Nacht wird das deutlich, wenn die Ampeln auf der leeren Straße rasch auf Grün für die eigene Fahrtrichtung schalten. An den meisten Kreuzungen sind unter dem Asphalt Induktionsschleifen angebracht, die auf den einzelnen Fahrspuren erkennen, ob sich dort ein Auto befindet. Damit werden die Ampeln je nach Bedarf geschaltet und dies verringert die Wartezeit. Die Technik reagiert hier in eingeschränktem Maße auf das Verhalten und die Bedürfnisse von Menschen.
Plötzliche Verhaltensänderungen können ganze Systeme aus dem Gleichgewicht bringen, wenn sie nicht flexibel angepasst werden können. Viele Onlineplattformen, die künstliche Intelligenz zur optimalen Steuerung von Inhalten und Vorschlägen einsetzen, sahen sich 2020 mit dem Covid-Lockdown konfrontiert – und mit stark veränderten Verhaltensweisen der Menschen. Die Algorithmen, die durch große Datenmengen und viel Arbeit der letzten Jahre zu optimierten Vorschlägen führen sollten, konnten mit Bestellungen zu Klopapier, Desinfektionsmitteln oder der Bestellung von Gütern, die üblicherweise nicht online vorgenommen wurden, nichts anfangen und waren mehr als verwirrt. Und die Ampeln an den nun fast leeren Straßen fuhren tagsüber ihre langen Schaltzyklen nach wie vor so, als ob es das sonst übliche Verkehrsaufkommen gäbe.
Wir Menschen haben mehr Einfluss auf Technologien, als wir annehmen. Sehr zum Leidwesen der Ingenieure, die solche Technologien entwickeln. Für sie stehen wir im Mittelpunkt und dort stehen wir im Weg. Um einen Liedtext des seligen österreichischen Liedermachers und Humoristen Georg Kreisler über Wien und die Wiener etwas holprig umzumünzen und stattdessen das Wehklagen von Ingenieuren auszudrücken:
Читать дальше