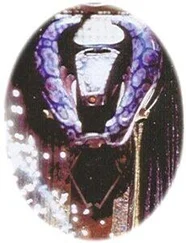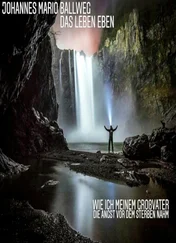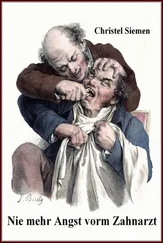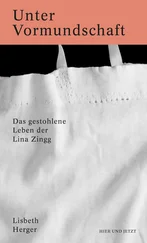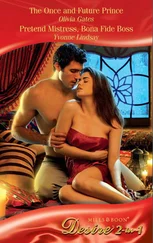Brille mit Hülle
Brille mit Hülle
 Zünder
Zünder
 Gabel
Gabel
 Gebogenes Messer
Gebogenes Messer
 Kohlekreide
Kohlekreide
 Bretter
Bretter
 Papier
Papier
 Weiße Kreide
Weiße Kreide
 Wachs
Wachs
 Glasstücke
Glasstücke
 Feinzahnige Knochensäge
Feinzahnige Knochensäge
 Skalpell
Skalpell
 Inkhorn
Inkhorn
 Bleistiftmesser
Bleistiftmesser
 und einen Schädel
und einen Schädel
•Finde heraus, wie die Zunge des Spechts funktioniert.
Schon wieder die Zunge des Spechts und auf den nachfolgenden Seiten nochmals Einträge zu diesem Vogel:
•Mache die Bewegung der Spechtzunge (Fa’ il moto della lingua del picchio); 2
•Beschreibe die Zunge des Spechts und den Kiefer des Krokodils (Scrivi la lingua del picchio e la mascella del coccodrillo). 3
Menschliche Zungen, Spechtzungen und Krokodilkiefer. In seinem Wissensdurst hatte Leonardo da Vinci über die Jahre Dutzende Leichen von Menschen, aber auch von Pferden und anderen Tieren seziert. Damals von der Kirche nicht gern gesehen und sogar unter Strafe stehend waren das die ersten Ansätze von Wagemutigen wie da Vinci, den menschlichen Körper besser zu verstehen. Als Ingenieur, Maler, Skulpteur, Architekt und erster moderner Wissenschaftler war er stetig bestrebt, seine Disziplinen zusammenzubringen. Ja, eigentlich sah er sie gar nicht als getrennte Disziplinen an.
Um Gesichtsausdrücke und Körper in seinen Gemälden wirklichkeitsnah und lebendig darstellen zu können, musste er seinem Verständnis nach Muskeln und deren Wirkungsweisen verstehen. Das uns noch heute mysteriös erscheinende Lächeln der „Mona Lisa“ ist das Ergebnis seiner jahrzehntelangen Studien und der Suche nach dem Funktionieren und Wirken der Natur. Er wollte verstehen, wie Muskeln die Lippen, Wangen oder Stirn bewegten.
Die menschliche Zunge erschien ihm dabei als Ausreißer besonders interessant. Es handelt sich um den einzigen Muskel, der nicht durch Kontraktion, also durch Zusammenziehen wirkt, sondern durch Ausdehnung. Und weil er eben ein Universalinteressierter war, wollte er das beim Specht auch verstehen, vermutlich, um Erkenntnisse zur menschlichen Zunge zu erhalten. Immerhin war es leichter und weniger riskant in Bezug auf die Obrigkeit, an einen Tierkadaver zu gelangen als an eine menschliche Leiche.
Was ihm natürlich erschien – nämlich verstehen zu wollen, wie Dinge funktionieren, und aktiv danach zu streben, diese Fragen zu beantworten und Experimente zu entwickeln und auszuführen –, erfordert eine ganze Menge an Energie. Es wäre einfacher, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind, und sie nicht weiter zu hinterfragen. Nicht aber Leonardo da Vinci. Sein ganzes Leben lang war er auf der Suche, die Welt zu verstehen und seine Arbeit aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse zu perfektionieren.

Abbildung 1: Bildnis der Ginevra de’ Benci, datiert zwischen 1474 und 1478
Wie sehr sich das auf seine Kunst auswirkte, sieht man am Vergleich zweier Porträts. Das von Ginevra de’ Benci fertigte er als junger Künstler zwischen 1474 und 1478 an, das als Mona Lisa bekannte Porträt der Lisa del Giocondo 30 Jahre später.
Da Vincis Ginevra ist technisch durchaus gekonnt und dem Stand der Zeit würdig. Allerdings ist eine nicht zu übersehende Leere im Gesicht, die das ganze Porträt wenig natürlich und lebhaft erscheinen lässt. Die ausdruckslosen Augen, die bleiche Haut, die wie angepappt wirkende Lockenpracht, die da Vinci als Lockenträger selbst so sehr liebte, lassen uns Ginevra als Zombie erscheinen.

Abbildung 2: Mona Lisa, datiert zwischen 1503 und 1506
Ganz anders die bei den Franzosen als La Joconde bekannte Mona Lisa. Nicht nur hatte da Vinci eine viel feinere Maltechnik entwickelt, auch die Perspektiven, die Farben, die Schatten und letztendlich die Erfassung der Gesichtszüge zeigen bei der Mona Lisa eine bis dahin unerreichte Stufe der Porträtmalerei. In ihrem geheimnisvollen Lächeln, das uns sogar noch 500 Jahre nach ihrer Erschaffung fasziniert, manifestiert sich Leonardo da Vincis Können, das er nicht nur durch die Malpraxis und den unermüdlichen Drang nach neuen Erkenntnissen verbesserte, sondern auch in seiner Furchtlosigkeit, verbotenerweise Leichen zu sezieren, um die Funktionsweise und das Zusammenspiel von Muskeln und Gewebe zu verstehen.
Was Leonardo da Vinci uns vorlebte, ist das, was wir heute als „Renaissancemensch“ bezeichnen. Den Universalgelehrten, den Polymath, der ein Leben lang seine Neugierde selbst für die unscheinbarsten Phänomene aufrechterhält.
Das steht im Kontrast zur digitalen Anti-Renaissance des modernen Menschen. Seit einiger Zeit stelle ich dem Publikum auf Konferenzen in oder Delegationsteilnehmern aus Europa ähnliche Fragen:
•Wer verwendet ein Smartphone mit Gesichtserkennung?
•Wer hat einen Sprachassistenten zu Hause?
•Wer hat schon einmal einen Ridesharing-Anbieter wie Uber verwendet?
•Wer spielt Pokémon Go?
•Wer hat schon einmal eine Spechtzunge skizziert?
Man muss dabei berücksichtigen, dass die Leute, denen ich diese Fragen stelle, nicht die Otto Normalverbraucher sind. Es handelt sich bei ihnen um Innovationsmanager, Produktentwicklungsleiter, Vorstände, IT-Berater, digitale Evangelisten, Journalisten zu digitalen Themen und Trends. Menschen, zu deren Aufgabe unter anderem zählt, ihre Organisationen und Gesellschaften in die Zukunft zu führen.
Die vorgebrachten Ausreden habe ich alle gehört: Das iPhone ist zu teuer. Ich brauche mein iPhone X nicht, ich habe es weitergeschenkt. Der Sprachassistent hört immer zu. Und überhaupt: Wer braucht so etwas?
Читать дальше
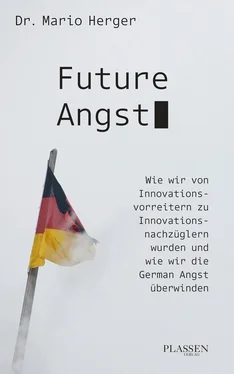
 Brille mit Hülle
Brille mit Hülle