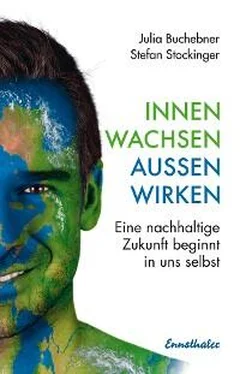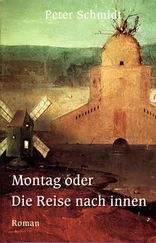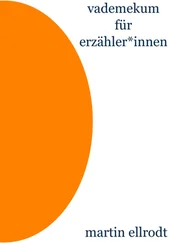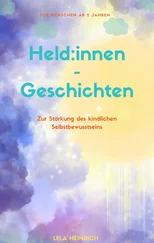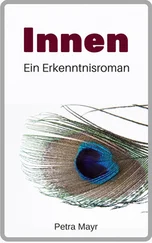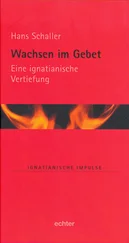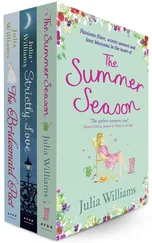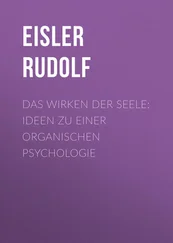Nicht nur die wissenschaftlichen Ergebnisse sprechen diese Sprache, auch in unserem Alltagsleben ist dieser Wandel spürbar. Dass die Pegelstände großer Flüsse in den vergangenen Jahrzehnten gesunken sind, ist nichts Neues. In den letzten Sommern kam es durch die extremen Dürreperioden dazu, dass sie noch einmal deutlich weniger Wasser führten als sonst und sogar die Schifffahrt eingestellt werden musste. 2018 etwa hatte der Rhein als Deutschlands wichtigste Wasserstraße bei Düsseldorf zeitweise nur noch eine Fahrwassertiefe von weniger als zwei Metern. 14Neben dem Wasserverkehr musste in diesem Jahr auch die Landwirtschaft starke Einbußen hinnehmen. Die Hektarerträge deutscher Landwirte lagen bei Getreide um 16 Prozent niedriger als in den Vorjahren, und wer im damaligen Sommer per Auto oder Bahn quer durch Mitteleuropa unterwegs war, konnte sich von den vertrockneten Feldern selbst überzeugen. 15
Neben den Feldern hat auch unser geliebter Wald massive Probleme mit den veränderten Temperaturen der letzten Jahrzehnte. Unsere hochgezüchteten Fichtenwälder wollen es eigentlich kühl und sondern bei zu starker Hitze ein Stresshormon ab, das wiederum den Borkenkäfer anlockt. In einer Monokultur voll von Fichten hat dieser dann ein leichtes Spiel und kann binnen einer Saison ganze Waldstriche dem Erdboden gleichmachen. Auch deshalb, weil er sich aufgrund längerer Wärmeperioden jährlich einmal mehr fortpflanzen kann, als dies früher der Fall war.
Unsere Normalität ist eine Krise
Klimawandel, Artensterben und Plastikverschmutzung sind nur drei von vielen Dutzenden Beispielen, die bezeugen, wie wir Menschen auf die Natur Einfluss nehmen und sie schädigen oder irreversibel zerstören. Im Anthropozän, dem Erdzeitalter des Menschen, haben wir bereits sieben von neun planetaren Grenzen überschritten und damit die Stabilität und Resilienz unserer Ökosysteme massiv gefährdet. 16Wer behauptet, dass unsere Normalität auch ohne Coronavirus einer einzigen Krise gleicht, der liegt also gar nicht so falsch.
Lange Zeit haben wir Menschen uns eingeredet, dass ökologische Probleme nur rein ökologische Folgen mit sich bringen und uns deshalb nicht unmittelbar zu kümmern brauchen. Somit wurde der Schutz der Natur eher als Benefit denn als Notwendigkeit, geschweige denn als etwas Selbstverständliches gesehen. In der Realität haben ökologische Probleme aber immer auch soziale und wirtschaftliche Auswirkungen zur Folge und betreffen uns damit ganz direkt. Als etwa die Ölbohrplattform Deepwater Horizon im Golf von Mexiko nach einer Explosion versank, zerstörten die 800 Millionen Liter an austretendem Erdöl nicht nur das dortige Ökosystem. 17Auch Tausende von Fischern verloren ihre Existenz und der Tourismus und viele zuliefernde Betriebe mussten schließen. 18
Wenn heute immer mehr Menschen aufgrund von Trockenheit, Unfruchtbarkeit, Wassermangel oder Waldrodung ihre bäuerliche Lebensgrundlage verlieren, dann machen sie sich auf und flüchten in andere Länder. Dies führt zu massiven Problemen in überfüllten Flüchtlingscamps und in der Folge auch zu sozialen Spannungen in unserer Gesellschaft, die, einfach formuliert, mit fremden Kulturen meist nicht wirklich umzugehen weiß.
Ökologische Katastrophen sind also eng mit sozialen und wirtschaftlichen Problemen verflochten und können zu Hunger, Armut, globaler Ungerechtigkeit oder im schlimmsten Fall zu gewalttätigen Auseinandersetzungen führen. Und was lange Zeit scheinbar nur auf fremde Länder zutraf, setzt sich mittlerweile auch bei uns immer weiter durch. Unser hiesiges Bienensterben führt auch zum Imkersterben und das wiederum bedroht die Existenz der ohnehin ständig unter Stress stehenden Landwirte. Der Borkenkäfer rodet nicht nur unsere Wälder, er führt auch viele Waldbesitzer in den Ruin. Und unsere durch Stickoxide und Feinstaub belastete Luft führte allein 2016 zu mehr als 400.000 Todesfällen innerhalb der EU. 19
All diese Dinge wissen wir und finden sie bedenklich, tragisch oder sogar gefährlich. Doch gleichzeitig ist dies eben auch unsere akzeptierte Normalität. Solange es aber normal ist, unser Land in einzelne Monokulturen zu verwandeln, unsere Felder mit Gift zu bespritzen und unsere Luft mit Dutzenden Abgasen zu verunreinigen, so lange wird sich auch nichts ändern. Und so wird diese Normalität noch zu vielen weiteren Krisen führen und irgendwann unsere eigene Existenz bedrohen.
Wie aber könnte unsere Welt aussehen, wenn wir beginnen würden, diese geltende Normalität von ihrem hegemonialen Thron zu stoßen? Was wäre, wenn es ein neues »Normal« gäbe, das unsere Lebensgrundlagen nicht langfristig ruiniert? Und was, wenn es an uns läge, diese neue Normalität zu erschaffen?
1.2 Der globale Zustand als Spiegel unserer selbst
Im 21. Jahrhundert ist es die große Herausforderung unserer Spezies, wieder in Einklang mit der Natur zu kommen und sie in all unserem Tun mit zu bedenken. Damit uns dies als Kollektiv gelingt, braucht es die Anstrengung und Veränderung von jedem Einzelnen von uns. Wie wir bereits gesehen haben, ist unser Umgang mit der Natur eher von Zerstörung denn von Respekt und Miteinander geprägt. Die Verbindung zur Natur ist uns über weite Bereiche abhandengekommen, und viele Menschen haben darüber hinaus auch die Verbindung zu sich selbst verloren.
Könnte es also sein, dass es Parallelen gibt zwischen der Art, wie wir mit der Erde umgehen, und der Art, wie wir mit uns selbst umgehen? Könnte es sein, dass wir Menschen ähnlich kränkeln wie unser gesamter Planet? Wäre es möglich, dass der Zustand der Welt lediglich ein Spiegel für den inneren, geistigen und emotionalen Zustand der Menschheit ist? Wir sehen ein paar spannende Parallelen, die wir im Folgenden näher beleuchten wollen.
Burn-out im Menschen, Burn-out in der Natur
Beginnen wir mit der immerzu produktiven Marktwirtschaft. Ob diese wirklich produktiv ist, sei dahingestellt. Fakt ist, sie will es sein! Und da uns in unserer Kurzsichtigkeit nichts Produktiveres einfällt als eine Maschine, haben wir die gesamte Arbeitswelt auch entsprechend diesem Maschinen-Denken gestaltet. Nicht nur das, wir haben es sogar so weit gebracht, dass sich der heutige Mensch seine eigene Daseinsberechtigung erst verdienen muss. Es scheint, als wären wir nur dann wertvoll, wenn wir funktionieren, uns zu Tode arbeiten und dabei irgendetwas produzieren.
Mit diesem maschinellen »Funktionieren« in der Arbeitswelt geht die Tatsache einher, dass wir auch gesellschaftlich funktionieren müssen. Wir sollen brav sein, zur Arbeit gehen, unser Geld verdienen und es am besten allen anderen recht machen. Ob wir es dadurch auch uns selbst recht machen, steht oft nicht zur Debatte. Solche Bestrebungen beschreiben Psychotherapeuten wie der Deutsche Wolf Büntig als eine Dynamik, die man an der Basis aller psychosomatischen Krankheiten sieht. 20Und dass diese vor allem in der Arbeitswelt immer stärker zunehmen, ist seit dem Massenphänomen Burn-out kein Geheimnis mehr.
In einer 2019 veröffentlichten Studie mit rund tausend Erwachsenen wurde festgestellt, dass 19 Prozent der österreichischen Bevölkerung zumindest erste Anzeichen dieser Störung aufweisen, 17 Prozent sich in einem Übergangsstadium befinden und 8 Prozent als erkrankt gelten. 21Die Studienautoren erklären ferner, dass sich gemäß ihrer Forschung nur rund die Hälfte, 52 Prozent, als gesund betrachten können. Unser aktueller Umgang mit Arbeit lässt uns also ausbrennen und macht uns im schlimmsten Fall sogar krank. Zur Erklärung: »Ein Burn-out ist ein emotionaler, geistiger und körperlicher Erschöpfungszustand nach einem vorangegangenen Prozess hoher Arbeitsleistung, Stress und/oder Selbstüberforderung.« 22
Die Analogie zur Natur ist in diesem Fall recht einfach zu sehen. Auch unser Planet leidet an einer Art Burn-out. Unser hohes, krank machendes Arbeitspensum führt natürlich auch zu einer dauerhaften Produktion aller möglichen Güter und dies wiederum zur Erschöpfung des Planeten. Die nachwachsenden wie auch die nicht nachwachsenden Ressourcen erschöpfen sich, die fruchtbaren Böden gehen zur Neige und die meisten Ökosysteme stehen, ebenso wie wir Menschen, ständig unter Stress.
Читать дальше