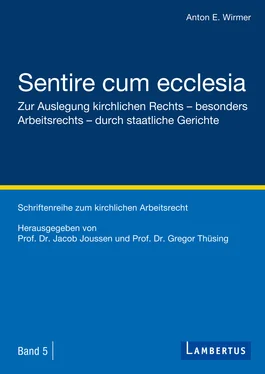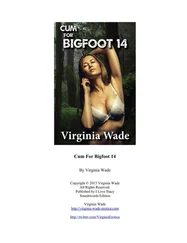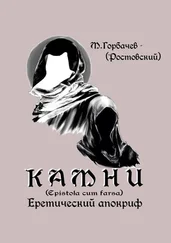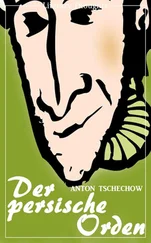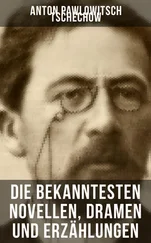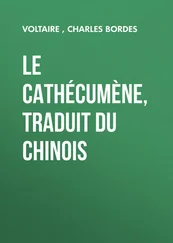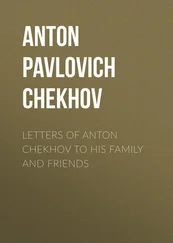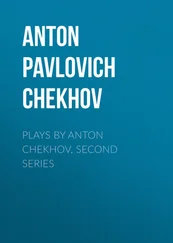Bei der Methodendiskussion ging es teilweise um den Stellenwert der grammatikalischen Methode oder des Wortlaut-Arguments. Im 19. Jahrhundert wurde dieser Methode von den Gerichten großes Gewicht oder sogar ein Vorrang von anderen Kriterien zuerkannt. In England wurde diese Periode als das Zeitalter der strengen Buchstabentreue bezeichnet. 49
Der Bedeutungsgewinn dieses Kriteriums beruhte vor allem auf Veränderungen im Verfassungsgefüge. Es war die Zeit, in der die gesetzgebende Gewalt an Souveränität gewann und das Prinzip der Gewaltenteilung die Rechtsprechung strikter an das geschriebene Gesetz binden sollte. Daneben spielte wohl auch der Siegeszug des positivistischen Rechtsbegriffs eine Rolle. Ethische oder wertbezogene Erwägungen sollten bei der Rechtsfindung keine Bedeutung haben. 50Als die Faktoren, die zu dieser Entwicklung geführt haben, sich abschwächten, erfolgte gegen Ende des Jahrhunderts wieder eine stärkere Ausrichtung auf die teleologische Methode. Im Gegensatz zu eher formal argumentierenden Kulturen messen mehr wertbezogene Rechtskulturen dem hinter einer Norm stehenden Gesetzeszweck sowie Vernunft- oder Gerechtigkeitserwägungen eine höhere Bedeutung zu.
2. Der Umfang der Gesetzesbindung der Gerichte
Eine bis in die heutige Zeit reichende Kontroverse gibt es über den Rang der historischen Auslegungsmethode im Verhältnis zu den anderen Kriterien. Es geht um die Frage, ob für die Ermittlung des Gesetzeszwecks der Wille des historischen Gesetzgebers maßgeblich sein soll oder ob es einen sog. objektivierbaren Willen des Gesetzgebers gibt. 51Mit anderen Worten: Ist ein Gesetz entstehungszeitlich (ex tunc) oder geltungszeitlich (ex nunc) zu interpretieren?
In der römischen Rechtstradition spielte die historische Entstehung des Gesetzes nur eine untergeordnete Rolle. Das Gesetz selbst hatte eine „voluntas“ oder „sententia“, also einen sachgerechten und zweckmäßig erscheinenden Sinn. 52Erst mit der Aufklärung und verstärkt zu Beginn des 19. Jahrhunderts begann ein Umdenken. Ziel der Auslegung sollte sein, den Sinn zu ermitteln, den das Gesetz zu der Zeit, in der es erlassen wurde, haben sollte. Die richtige Methode sei daher die historische Gebots- und Normzweckforschung (subjektive Auslegungsmethode). 53Gegen Ende des 19. Jahrhunderts erfolgte wieder eine Hinwendung zu einem stärker zweckorientierten Ansatz im Hinblick auf heutige Lebensvorgänge. 54Nach dieser Methode verselbständigt sich das Gesetz vom Gesetzgeber und gewinnt eine eigene Zielrichtung und Dynamik. Die Rechtsprechung, die Träger dieses Prozesses ist, erfuhr durch dieses Denken eine spürbare Aufwertung sowie auch einen Machtzuwachs im staatlichen Gefüge.
Bei diesem über Generationen geführten Methodenstreit geht es nicht nur um den Rang der historischen Auslegungsmethode im Verhältnis zu den anderen Kriterien, es geht vor allem um die Strenge der Gesetzesbindung der Gerichte bzw. die Spielräume, die dem Rechtsanwender bei der Interpretation der Gesetze eingeräumt sind. Im Kern geht es daher um die Definitionskompetenz über den materialen Inhalt der geltenden Rechtsordnung.
Je größer die Spielräume sind, die den Gerichten bei der Auslegung und Anwendung von Gesetzen eingeräumt sind, je größer ist auch die Gefahr, dass politische Veränderungen, zeitgebundene Wertvorstellungen oder richterliche Eigenwertungen über die in jedem Recht enthaltenen Allgemeinbegriffe und Generalklauseln Einfluss auf die Interpretation von Gesetzen gewinnen. Exemplarisch dafür stehen die Methodenkontroversen zu den Verfassungswechseln nach 1919, 1933 und 1945. Besonders die NS-Zeit hat gezeigt, wie leicht auch überkommene Gesetze auf neue politisch motivierte Wertsysteme umgedeutet werden können. 55Die Gerichte beriefen sich teilweise auf die nationalsozialistische Weltanschauung als einen außergesetzlichen Interpretationsmaßstab. 56
3. Europäische Perspektiven
Bei einem Vergleich der Auslegungsmethoden in verschiedenen kontinentalen Rechtsordnungen in Europa bestehen nach verbreiteter Meinung in der Literatur viele Gemeinsamkeiten. Unterschiede bestünden nur in Einzel- und Detailfragen und diese seien weniger inhaltlicher Natur als eine Frage der Terminologie. So stehe dem deutschen Viererkanon der Auslegungselemente in Frankreich das von Chr. Thomasius schon vor F. C. v. Savigny entwickelte Zweier-Schema von grammatikalischer und logischer Auslegung gegenüber. Die Aspekte der Systematik und des Normzwecks würden bei dem logischen Kriterium mitberücksichtigt. 57
Unterschiedlich ist in der Literatur die Beurteilung der Gesetzesinterpretation in England im Vergleich zu Kontinent. Teilweise wird vertreten, für ein englisches Gericht gelte traditionell und auch heute noch das Gebot sog. Objektiver Auslegung. Die Entstehungsgeschichte und andere „extrinsic materials“ dürften nicht berücksichtigt werden. 58Demgegenüber vertritt St. Vogenauer in einer umfangreichen Studie die These einer grundlegenden Einheit der Auslegungspraxis in Europa. Die Differenzen zwischen dem Kontinent und dem englischen Recht seien nicht größer als zwischen den verschiedenen kontinentalen Rechtsordnungen. Dies betreffe sowohl die Auslegungskriterien als auch deren Gewichtung. In keiner der untersuchten Rechtsordnungen werde einem Kriterium absoluter Vorrang vor anderen Methoden eingeräumt. Es sei auch kein festes Rangverhältnis der Auslegungselemente festzustellen. 59
Nach dieser Untersuchung haben die englischen Gerichte zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert die kontinentalen Auslegungsgrundsätze übernommen. England sei insofern bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts ebenso wie Deutschland und Frankreich ein Teilgebiet des damals herrschenden Gemeinen Rechts gewesen. Auch die historischen Schwankungen in der Methodendiskussion seien in den europäischen Ländern im Wesentlichen ähnlich verlaufen. Nur der Übergang von einer Phase in die andere habe sich in England jeweils einige Jahre später vollzogen. 60
IV. Heutige Tendenzen
1. Auslegung als Diskurs
Nach wohl allgemeiner Auffassung ist Ausgangspunkt jeder Auslegung juristischer Texte der mögliche Wortsinn gesetzlicher Regelungen. Da aber Begriffe selten eindeutig sind, gibt es i.d.R. einen Spielraum möglicher Wortbedeutungen. 61Innerhalb dieses Rahmens muss sich die Interpretation bewegen. Die Grenze des möglichen Wortsinns ist auch die Grenze der Auslegung. 62Jenseits dieser Grenze geht es nicht mehr um Auslegung, sondern um Rechtsfortbildung. Ziel der Auslegung ist es, die konkrete Bedeutung abstrakter Gesetzesbegriffe zu bestimmen. Erst dadurch gewinnt eine Norm jene inhaltliche Bestimmtheit, die erforderlich ist, um sie auf einen konkreten Lebenssachverhalt anwenden zu können. 63Allerdings vollzieht sich die Konkretisierung einer Rechtsnorm nicht losgelöst von der Lebenswirklichkeit, sondern i.d.R. mit Blick auf den betroffenen Sachverhalt. Dies bedeutet, dass sich die Frage, ob ein bestimmter Sachverhalt unter eine Norm fällt, im Wesentlichen schon bei der Bestimmung des konkreten Bedeutungsgehalts der Norm entscheidet. Es ist eine Frage der Auslegung und nicht erst der Subsumtion. 64
Auslegung ist keine exakte Methode, die normalerweise zu eindeutigen Ergebnissen führt. Sie vollzieht sich vielmehr in einem Abwägen verschiedener Argumente, die es rechtfertigen, den Gesetzesbegriffen diesen oder jenen genaueren Sinn beizulegen. 65Nach dem BVerfG hat Auslegung den „Charakter eines Diskurses, in dem auch bei methodisch einwandfreier Arbeit nicht absolut richtige, unter Fachkundigen nicht bezweifelbare Aussagen dargeboten werden, sondern Gründe geltend gemacht, andere dagegen gestellt werden und schließlich die besseren Gründe den Ausschlag geben sollen“. 66In dem Prozess der rationalen Strukturierung der verschiedenen Erwägungen dienen insbes. die Auslegungskriterien oder auch allgemein anerkannte Rechtsgrundsätze als diskussionsleitende Gesichtspunkte der Argumentation.
Читать дальше