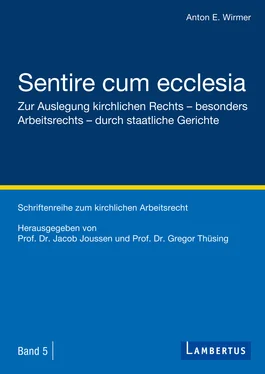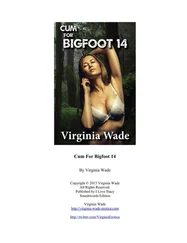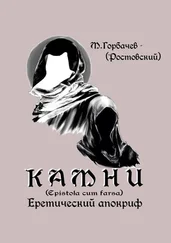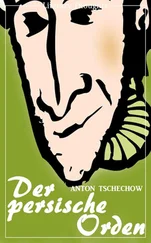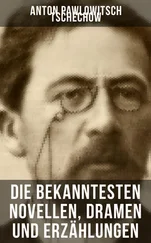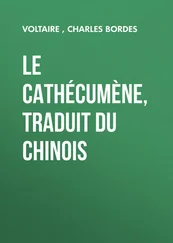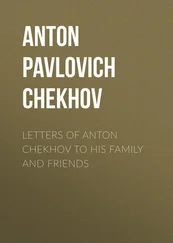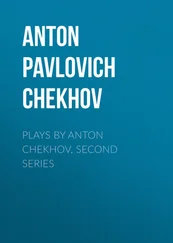Sie stellt nur eine begrenzte Sprache zu Verfügung, die nicht in der Lage ist, sämtliche juristischen Vorgänge abzubilden. Dies gilt vor allem für im Recht häufig notwendige Abwägungsvorgänge beim Zusammentreffen und bei Konflikten von Normen. Zur Bewältigung der Probleme, die sich aus der Vieldeutigkeit und Wandelbarkeit von Rechtsbegriffen ergeben, sind noch andere Methoden erforderlich.
II. Auslegung und Methodenpluralismus
1. Die Entwicklung wissenschaftlicher Methodenlehren
Angesichts der geschilderten hermeneutischen Unsicherheiten hat die Juristen schon seit jeher die Frage beschäftigt, wie die Auslegung von Rechtstexten möglichst objektivierbar gestaltet werden kann, insbes. ob es dafür Regeln und Methoden gibt. Auf der einen Seite muss Rechtsanwendung verlässlich und müssen juristische Entscheidungen für die Betroffenen einer rationalen Kontrolle zugänglich sein. Auf der anderen Seite muss Recht flexibel genug sein, um sich auf veränderte Verhältnisse und Rahmenbedingungen einstellen zu können, gerade wenn Recht über längere Zeiträume und Jahrhunderte gilt oder gelten soll. Beiden Aspekten gerecht zu werden, hat sich im Laufe der Rechtsgeschichte als eine nicht leicht zu lösende Aufgabe erwiesen.
Viele Faktoren sind dabei zu berücksichtigen. Recht ist kein isoliertes, für sich bestehendes Gebilde, sondern ein Spiegelbild der jeweiligen historischen Gesamtsituation. Alle bedeutsamen kulturellen, ökonomischen und politischen Faktoren und Tendenzen wirken auf das Recht ein und werden ihrerseits durch das Recht geprägt. 30Die Entwicklung der juristischen Auslegungsmethoden ist immer auch eine Auseinandersetzung um die Freiheiten, die dem Rechtsanwender bei der Interpretation von Rechtstexten eingeräumt werden, gewesen. 31
Das Römische Recht hatte noch keine ausgebaute Methodenlehre zur Auslegung von Rechtstexten entwickelt. Der „corpus juris civilis“ des Oströmischen Kaisers Justinian enthielt lediglich zahlreiche Interpretationsmaximen und Argumente, sogenannte „regulae juris“, die meist auf Rechtsansichten klassischer römischer Juristen zurückgingen. 32Auch diese gerieten aber in den folgenden Jahrhunderten weitgehend in Vergessenheit. Erst nach der Wiederentdeckung der Rechtssammlung im 11. Jahrhundert erlangten sie eine größere Bedeutung, die bis ins 17. Jahrhundert anhielt. Im Zeitalter der Aufklärung wurde versucht, die unterschiedlichen Maximen zu ordnen und zu systematisieren. 33
Von einer geschlossenen Methodenlehre kann erst ab dem Rechtslehrer v. Savigny gesprochen werden. Er war Haupt der historischen Rechtsschule und hat 1840 aufbauend auf dem damaligen Stand der juristischen Methodendiskussion 34zuerst ein Dreierschema und wenig später ein Viererschema von Auslegungskriterien entwickelt: Die grammatikalische, logische, systematische und historische Auslegungsmethode. 35Das grammatikalische Element bedeutet die Interpretation nach dem Wortlaut und den Regeln der Grammatik, das logische das Verhältnis der Gesetzesbegriffe im Satzgefüge sowie dem Kontext und das historische Kriterium die Interpretation nach dem Verständnis des historischen Gesetzgebers und den Umständen, die zum Erlass des Gesetzes führten. 36
Mit dem Systemargument war gemeint, dass jede Rechtsnorm nicht isoliert für sich steht, sondern Teil eines größeren Ganzen oder Rechtssystems ist und richtig nur in diesem Rahmen verstanden werden kann. v. Savigny bezieht das Kriterium auf den „inneren Zusammenhang, welcher alle Rechtsinstitute und Rechtsregeln zu einer großen Einheit verknüpft. 37“ Er hat diesem Kriterium eine besondere Bedeutung beigemessen. Aber auch schon vorher war anerkannt, dass bei der Interpretation von Rechtsvorschriften auch Normen aus anderen Rechtsquellen zu berücksichtigen sind. Das galt besonders für die Auslegung im Einklang mit dem Gewohnheitsrecht und – bei Partikulargesetzen – im Einklang mit dem sog. Gemeinen Recht. 38
Eine Rangfolge der vier Auslegungskriterien hat v. Savigny nicht empfohlen. Vielmehr müssten alle Aspekte berücksichtigt werden, wobei je nach Sachlage das eine oder das andere größere Bedeutung gewinnen könne. 39Er hat außerdem schon darauf hingewiesen, dass es notwendig sein könne, weitere Hilfsmittel einzubeziehen, wenn der Gesetzestext den Regelungsgedanken nicht klar genug zum Ausdruck bringe. Dann seien die vier genannten Elemente nicht ausreichend und auf weitere zurückzugreifen wie vor allem – in heutiger Terminologie – der Normzweck einer Regelung und eine Folgenabschätzung. 40
2. Die Bedeutung weiterer Auslegungselemente
Im Laufe der weiteren Entwicklung, vor allem ab der Mitte des 20. Jahrhunderts hat der Viererkanon – auch wenn er nicht gesetzlich verankert wurde – in Deutschland grundsätzlich Eingang in die Rechtstheorie und -praxis gefunden, allerdings in einer leicht veränderten Form. 41Das logische Element wurde durch das teleologische Kriterium im Sinne der „ratio legis“ ersetzt. Teilweise ist es auch im Argument der Systematik aufgegangen. Einige Autoren plädieren heute dafür, beim Viererkanon zwischen Auslegungsziel und Auslegungsmittel zu unterscheiden. Der Normzweck sei das zentrale Ziel jeder Gesetzesauslegung. Die anderen Kriterien seien Mittel, um den richtigen Normzweck zu erkennen. 42
Neben den von v. Savigny genannten Elementen haben im Laufe der europäischen Rechtsgeschichte auch andere Kriterien oder Wertungsmaßstäbe bei der Gesetzesauslegung eine Rolle gespielt. Zu diesen zählen Argumente der Gerechtigkeit und Billigkeit, aber auch der Zweckmäßigkeit und der Vernunft. Teilweise gehörten sie schon zu den Standardmaximen des Römischen Rechts wie z. B. das „argumentum ad absurdum“, das ungereimte oder absurde Ergebnisse vermeiden sollte. Auch der Gedanke der Zweckmäßigkeit oder praktischen Wirksamkeit einer Rechtsnorm lässt sich bis ins Römische Recht zurückverfolgen. 43Als “effet utile“ hat er Eingang in das französische Recht und das Völkervertragsrecht gefunden und wurde sogar zu einer Auslegungsmaxime des Gemeinschaftsrechts der EU. Außergesetzliche Wertungsmaßstäbe erlangten größere Bedeutung auch unter totalitären Regimen des 20. Jh. In der NS-Zeit galten in der Rechtsprechung des Reichsgerichts die NS-Weltanschauung und das gesunde Volksempfinden als außergesetzliche Interpretationsmaßstäbe. 44
Eine wechselvolle Geschichte hatte der aus dem römischen Recht kommende Grundsatz der Billigkeit oder „aequitas“ (Gleiche Entscheidung bei gleich gelagerten Fällen). Ab der nachklassischen Periode spielte er bis zum Zeitalter des Humanismus eine erhebliche Rolle in der Auslegungslehre. Er wurde teilweise zum Sammelbegriff aller im Rahmen des Rechts möglichen ethischen Erwägungen. 45Ab dem späten 18. Jahrhundert wurde er nur noch als Orientierungshilfe für den Gesetzgeber, nicht aber mehr als Auslegungskriterium für die Rechtsanwendung akzeptiert. Für Kant war der Grundsatz der Billigkeit eine „stumme Gottheit, die nicht gehöret werden kann.“ 46Erst beim Übergang ins 20. Jahrhundert gewannen solche Erwägungen wieder an Bedeutung, meist allerdings im Rahmen von Wertungsmaßstäben, die aus der gesamten Rechtsordnung oder der Verfassung und den Grundrechten abgeleitet waren.
Eine unverminderte Bedeutung hat der Grundsatz der „aequitas“ im kanonischen Recht. Er ist dort sogar ein allgemeines Auslegungsprinzip und geht in seinem Verständnis über den Begriff der Billigkeit im weltlichen Recht hinaus, indem er auch Elemente der christlichen Barmherzigkeit aufgenommen hat. 47
III. Gesellschaftliche und politische Einflussfaktoren
1. Methodendiskussion
Der Vierer- Kanon der Auslegungskriterien bot allerdings, was den Stellenwert der einzelnen Kriterien und deren Rangfolge betrifft, weiterhin viel Spielraum für unterschiedliche Interpretationen und Gewichtungen; eine Folge der Tatsache, dass es weiterhin an einem Relevanzkriterium zur Bestimmung der Rangfolge und des Gewichts der verschiedenen Interpretationselemente fehlte. Dies hat sich als ein wesentliches Problem der juristischen Auslegungstheorie erwiesen. Über diese Fragen ist die Methodendiskussion in den letzten zwei Jahrhunderten nicht zur Ruhe gekommen. In den herrschenden Anschauungen haben sich sogar erhebliche Schwankungen ergeben. Es hat sich gezeigt, dass die Vorgehensweise bei der Interpretation von Gesetzen in hohem Maße auch abhängig ist von dem jeweiligen Zustand der Rechtskultur in einem Land und den herrschenden Rechtslehren. Verändert sich das Koordinatensystem der Rechtskultur, verändert sich häufig auch die Methodik der Gesetzesauslegung. 48Naturrechtsdenken, Rechtspositivismus oder Interessenjurisprudenz hatten jeweils auch eine unterschiedliche Sicht auf die Methodenfragen der Gesetzesauslegung.
Читать дальше