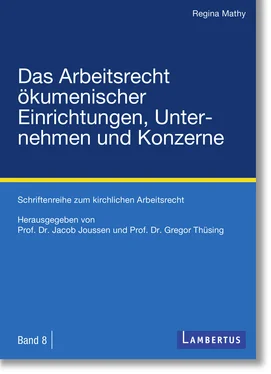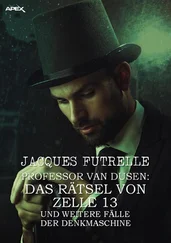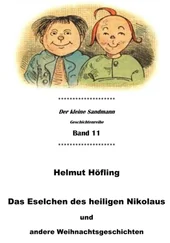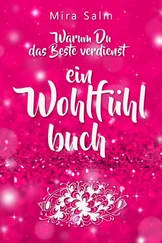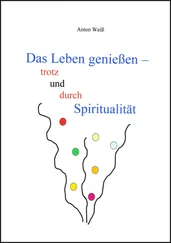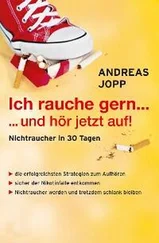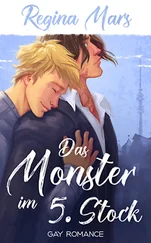I. Das ökumenische Unternehmen
II. Der ökumenische Konzern
1. Möglichkeiten der Errichtung einer konzernweiten Mitarbeitervertretung
a) Orientierung an der Konzernmutter
b) Vorgabe durch die Konzernmutter
c) Nach Tochtergesellschaften differenzierender Ansatz
2. Voraussetzungen einer gespaltenen Zuständigkeit
3. Gleichzeitige Errichtung einer erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung und einer Gesamtmitarbeitervertretung im Dienststellenverbund
4. Die ökumenische Holding
III. Fazit
§ 7 Ausblick: Neufassung eines ökumenischen kirchlichen Arbeitsrechts
A. Religiöser Konsens als Grundlage der Zusammenarbeit
B. Loyalitätspflichten im ökumenischen Dienst
I. Vorüberlegungen
1. Erfordernis der Konfessionszugehörigkeit
2. Konfessionsdifferenzierende Loyalitätsanforderungen
3. Kirchenaustritt
II. Leitlinien für gemeinsame Loyalitätsobliegenheiten
C. Gemeinsames ökumenisches Mitarbeitervertretungsrecht
I. Zugrundeliegendes Verständnis
II. Einheitliche Terminologie
III. Geltungsbereich
IV. Inhaltliche Leitlinien für die MVO-ÖD
D. Arbeitsrechtsregelung im ökumenischen Dienst
I. Arbeitsvertragsrichtlinien Ökumenischer Dienst
II. Tarifvertrag
E. Stellungnahme
§ 8 Zusammenfassende Thesen
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Die Autorin
Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2019 von der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn zur Promotion angenommen. Das Manuskript wurde im März 2019 fertiggestellt. Im Nachgang zur Disputation am 12. Juli 2019 wurden – soweit möglich und sinnvoll – Literatur und Rechtsprechung bis August 2019 berücksichtigt.
Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Gregor Thüsing LL.M. (Harvard), der mein Thema zur Betreuung annahm, mich bei Bedarf umsichtig und vorausschauend unterstütze, mir aber gleichzeitig den notwendigen Freiraum ließ. Während der Zeit an seinem Lehrstuhl habe ich nicht nur fachlich vieles gelernt; auch für meinen persönlichen Werdegang war die Zusammenarbeit mit ihm eine besondere Bereicherung. Sie wird mir stets in sehr guter Erinnerung bleiben.
Herrn Prof. Dr. Heinz-Jürgen Kalb danke ich für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens und seine wertvollen Hinweise. Meinem Doktorvater und Herrn Prof. Dr. Jacob Joussen danke ich für die Aufnahme in diese Schriftenreihe.
Der Konrad-Adenauer-Stiftung bin ich für das mir gewährte Promotionsstipendium zum Dank verpflichtet, das mir nicht nur eine finanzielle Sicherheit bot, sondern insbesondere auch die Teilnahme am Programm der Graduiertenförderung ermöglichte. In diesem Zusammenhang danke ich besonders Herrn Prof. Dr. Matthias Jacobs für die Unterstützung meiner Bewerbung. Der Kanzlei Pinsent Masons gebührt mein Dank für die großzügige Gewährung eines Druckkostenzuschusses.
Ganz herzlich danken möchte ich meinen Kolleginnen und Kollegen am Institut für Arbeitsrecht und Recht der Sozialen Sicherheit. Die fachlichen – und auch die weniger fachlichen – Diskussionen haben meinen Arbeitsalltag wirklich bereichert. Für die Unterstützung bei den Formalia und dem Korrekturlesen bedanke ich mich bei meiner Familie und meinen Freundinnen und Freunden; besonderer Dank gebührt an dieser Stelle Frau Maike Flink und Frau Sonja Steinhoff.
Von Herzen danke ich meinen Eltern, die mich während meiner gesamten Ausbildung uneingeschränkt unterstützt haben. Ohne ihre Geduld und seelischen Beistand wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen. Ihnen widme ich diese Arbeit.
| Bonn, im Oktober 2019 |
Regina Mathy |
§ 1Das Arbeitsrecht ökumenischer Einrichtungen, Unternehmen und Konzerne – eine thematische Hinführung
„Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast.“ (Joh 17, 21)
A. Der Liebesdienst am Nächsten – eine ökumenische Idee
Neben dem Zeugnis des Glaubens und der Feier der Liturgie ist die „Caritas“ als Dienst am Nächsten eine der drei Grundfunktionen des kirchlichen Lebens. 1Sie ist Lebensvollzug der Kirche im Sinne von tätiger Liebe und Wohltätigkeit (vgl. Mt 25, 40). Über Jahrhunderte hinweg nahmen die christlichen Kirchen allein die Sorge für Alte und Kranke wahr. Als Arbeitgeber haben die Kirchen seit Ende der 1960er Jahre in Deutschland erheblich an Bedeutung gewonnen. 2Hierdurch stieg der Anteil der Beschäftigten im kirchlichen Bereich erheblich an. Heute übernehmen öffentliche, private und freigemeinnützige Träger – letztere meist kirchliche – wesentliche Aufgaben des Sozialstaates. Die katholische Kirche und die evangelischen Kirchen sind gemeinsam mit ihren Wohlfahrtsorganisationen, die unter dem Dach des Deutschen Caritasverbandes 3bzw. der Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband 4organisiert sind, mit über 1,1 Mio. Beschäftigten in Deutschland nach dem Bund die zweitgrößten Arbeitgeber. 5Die meisten Einrichtungen werden nicht von den verfassten Kirchen, sondern von ihren Wohlfahrtsorganisationen getragen, bei denen auch die Mehrheit der Mitarbeiter 6beschäftigt ist. 7Die Tätigkeitsfelder sind vielfältig und betreffen sämtliche Lebensbereiche – von Kindergärten und Schulen bis hin zu Pflegeheimen, Krankenhäusern und Obdachlosenunterkünften. 8Es handelt sich um gewichtige Player am Markt. 9Im Krankenhausbereich 10, sowie in der ambulanten 11und stationären Pflege 12haben kirchliche Träger einen Marktanteil von etwa einem Drittel. Auch im Bereich der Kindertagesstätten und der Jugendhilfe sind sie ähnlich stark vertreten. 13Die organisierte „Caritas“ erreicht somit nahezu alle Bevölkerungsschichten 14und spielt in Deutschland eine wesentliche Rolle.
2017 jährte sich Martin Luthers Thesenanschlag und die daraus hervorgehende Trennung von Katholiken und Protestanten zum 500. Mal. Die katholische Kirche auf der einen und die evangelischen Kirchen auf der anderen Seite haben sich in der Folge religiös und politisch voneinander entfernt. Erste zaghafte Annäherungen von Gläubigen beider Seiten erfolgten Ende des 19. Jahrhunderts und mündeten zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Gründung der Ökumenischen Bewegung. Diese setzte sich die Einheit der Christen zum Ziel. Allerdings definierte die katholische Kirche noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts ihre konfessionelle Identität in Abgrenzung zu anderen christlichen Gemeinschaften 15und sprach sich gegen ökumenische Bestrebungen ihrer Mitglieder aus. Erst das Zweite Vatikanische Konzil (1962-1965) brachte ein Umdenken 16: Im Dekret über den Ökumenismus „Unitatis redintegratio“ (UR) heißt es: „Die Einheit aller Christen wiederherstellen zu helfen ist eine der Hauptaufgaben des Heiligen Ökumenischen Zweiten Vatikanischen Konzils.“ 17 . Das Bemühen um die Sorge zur Wiederherstellung der Einheit der Kirche sei nicht allein Aufgabe der Hirten, sondern vielmehr universale Verpflichtung aller Gläubigen, so bereits das konziliare Bekenntnis. 18Die Taufe im Namen Jesu Christ eint die Christenheit (vgl. Eph 4, 5; 1 Kor 12, 13). Kardinal Kasper betont: „Durch die gemeinsame Taufe ist schon jetzt eine fundamentale Einheit gegeben.“ 19
Nach einer Hochphase der Annäherung der katholischen Kirche und der evangelischen Kirchen Ende des vergangenen Jahrhunderts ist derzeit eine Stagnation erkennbar. 20Nachdem viele Gemeinsamkeiten festgestellt werden konnten, bleiben einige grundlegende Punkte offen. Nichts desto trotz gibt es – auch aufgrund der wirtschaftlichen Notwendigkeit – vermehrt Bestrebungen hin zu einer engeren Zusammenarbeit der Kirchen. Hierfür eignet sich kaum ein Bereich besser als der Dienst am Nächsten. 21Die gegenseitige Annäherung kann hier am eindrucksvollsten nach außen getragen werden. Seit einiger Zeit haben sich zunehmend Formen der Kooperation zwischen der katholischen Kirche und den evangelischen Kirchen bzw. ihren Wohlfahrtsorganisationen ergeben. 22Wenn auch weiterhin hinsichtlich einzelner Fragen ein unterschiedliches Glaubensverständnis besteht, so tritt dies in der gemeinsamen Arbeit in Altersheim, Krankenhaus oder im Sterbehospiz deutlich in den Hintergrund. 23Diese Zusammenarbeit dient nicht nur dem jeweiligen Zweck, gleichzeitig können sich Christen hierbei gegenseitig besser kennen und achten lernen.
Читать дальше